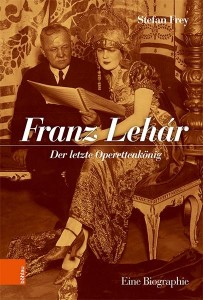 Stefan Frey: Franz Lehár. Der letzte Operettenkönig. Eine Biographie. – Wien [u.a.]: Böhlau, 2020. – 431 S.: 16 Farbtafeln und 31 s/w-Abb.
Stefan Frey: Franz Lehár. Der letzte Operettenkönig. Eine Biographie. – Wien [u.a.]: Böhlau, 2020. – 431 S.: 16 Farbtafeln und 31 s/w-Abb.
ISBN 978-3-205-21005-4 : € 35,00 (geb.)
Die historisch-kritische Publizistik zu Werk und Leben des Silbernen Operettenmeisters Franz Lehár (1870-1948) steht seit über zwei Jahrzehnten unter Führung des Münchner Theaterwissenschaftlers Stefan Frey. Einer 1995 erschienenen Dissertation bei Dieter Borchmeyer folgte 1999 unter dem Titel „Was sagt ihr zu diesem Erfolg.“ Franz Lehár und die Unterhaltungsmusik im 20. Jahrhundert eine Biographie mit Schwerpunkt auf Werkbetrachtung und Rezeptionsgeschichte. Diese galt seither nach wissenschaftlich-vergleichenden Maßstäben als unangefochtenes Hauptporträt des gebürtigen Ungarn. Gleich investigativ nahm Frey auch Lehárs Kollegen und Konkurrenten Emmerich Kálmán und Leo Fall ins Visier, gestaltet bis heute Operettenprogramme beim BR und anderen deutschen Sendeanstalten, legt nun aber auf ein Neues kräftig nach zum 150. Geburtstag von „Operettenkönig“ Lehár. Und zwar mit einer Neufassung der 1999-er Monographie, die mehr sein will als eine dem Jubiläum geschuldete Nachauflage. Inhaltlich verlagert sich der Schwerpunkt nun vom Werk auf die Person Franz Lehár, die Frey im Gegensatz zu den großen Vorläufern Jacques Offenbach und Johann Strauß für nach wie vor umstritten erklärt. Finden sich auch wesentliche Passagen von 1999 kaum verändert wieder, umschifft Frey ein Leser-Déjà-vu durch ein Aufgebot neu eruierter Quellen sowie der seitdem an Substanz erheblich bereicherten Fachliteratur zu den Popularmetiers. Und im Sinne jener heutigen Fachliteratur positioniert er auch seine in der Grundstruktur chronologisch dem Œuvre folgende Lehár-Untersuchung: Vorbei die Zeiten, als die wissenschaftliche Beschäftigung mit Operette zunächst deren künstlerischer Rehabilitierung galt. Angesagt ist die Kontextualisierung, die kulturgeschichtliche Bewertung eines Phänomens aus seinem zeitgeschichtlichen Umfeld heraus.
In einer Zeit virulenter politischer Umwälzungen vor und nach dem Ende des Habsburgerreiches habe der letzte große Repräsentant der Wiener Operette breiten Gesellschaftsschichten mentalen Halt geboten. Zur Kernthese erhebt Frey Lehárs seismographisches Sensorium für gesellschaftliche Umbrüche. Und dies umso frappierender, als Lehár einem vielschichtigeren, weltweiten Konglomerat an Rezipientenschichten gegenüberstand als etwa Jacques Offenbach mit eindeutigerer Referenz zum französischen Zweiten Kaiserreich. Nicht weniger kühn hebt Frey auf ein weiteres bedenkenswertes Lehár-Spezifikum ab: eine musikalische Suggestivkraft, die aus dem Unterbewussten Lehárs in das des Hörers dringt. Pointiert ausgedrückt: „Dass Lehárs Musik mehr weiß als ihr Schöpfer, ist ihre große Qualität und lag gewiss auch daran, dass er eben kein Intellektueller war (…).“ (S. 13) Und wie einen Sprengsatz, vor dem unverbesserliche Lehár-Apologeten gewarnt seien, exponiert der methodische Vorspann den eigentlichen Neuansatz gegenüber vormals gängiger Pseudowissenschaft: das Mitspracherecht der intellektuellen Opposition und ästhetischen Rivalen. „Eine Würdigung Franz Lehárs aus dem kulturellen Kontext seiner Zeit heraus bewegt sich zwischen Polemik und Glorifizierung, zwischen Hass und Verehrung – und damit dialektisch zwischen den Zeilen.“ (S. 14) Hält Frey selbst sich mit polarisierenden Wertungen eher bedeckt, lässt er dem Operettenmonarchen umso regelmäßiger die gefährlichsten publizistischen Erinnyen auflauern – an der feindlichen Spitze der bissfreudige Satiriker Karl Kraus, für die elitäre Avantgarde Theodor W. Adorno und – mit bildungsbürgerlicher Hybris – Richard Strauss.
Das stoffliche Gesamtpaket fasst Frey gegenüber 1999 zu größeren Einheiten zusammen. Deutlicher markiert erscheinen damit die Zäsuren von Vita und ästhetischen Kurswechseln. Zugegeben: Der kulturwissenschaftliche Anspruch fordert aufmerksames und konzentriertes Mitdenken. Doch die dicht getaktete Exkursion durch 431 eng bedruckte Seiten plus Anhang mit 1.069 Fußnoten und dienlichem Literatur- und Werkverzeichnis wird anhaltend belohnt und motiviert durch sprachliche Transparenz, S/W-Abbildungen im Text neben separaten Farbtafeln, und bei aller dokumentarischen Fülle, gebotenen Sachlichkeit und Fachspezifik – seien es Ausflüge in Musikanalyse, Literaturexegese, politische Zeitgeschichte, Kulturpsychologie, Finanzwirtschaft, Theaterpraxis oder Mediensoziologie – glückt Frey eine Spitzenleistung der journalistisch-feuilletonistischen Präsentation. Nicht selten ironisch pro und contra, hintersinnig in den Kapitelüberschriften, auch subjektiv wertend, etwa wenn ein „Rezept reizend realisiert“ (S. 143) scheint, bleibt es unterm Strich eine unverkennbar persönliche Stellungnahme des Fachmanns und Liebhabers.
Entgegen nüchternem Protokollieren beginnen Kapitel anregend nach Dramaturgie der Reportage: skurrile Episoden, nachgestellte Dialoge, Briefstellen oder vorausweisende Ereignisse. Umgekehrt verfährt am ehesten der einleitende Komplex „Vom Wunderkind zum Militärkapellmeister. 1870-1901“ konventionell kursorisch. Aber zumal in der Odyssee durch den Vielvölkerstaat, die Vater Lehár als Militärkapellmeister und Anhang abverlangt wurde und den Junior musikalisch prägte, beginnt die erste Schule des späteren Großmeisters und der slawische Grundton seines Idioms. Nach ungeliebtem Violinstudium nebst unerlaubtem Kompositionsunterricht in Prag, gefolgt von einem Orchesterjahr am Theater Elberfeld, wandelt er von Wien aus in den Fußstapfen des Vaters, lernt autodidaktisch bis zur Meisterschaft Instrumentation im direkten Experiment mit seinen Militärorchestern. Hatte er in Losoncz für seinen veristischen Opernerstling Rodrigo mit „‘Wie empfunden, so geschrieben‘ (…) gleich das Motto für sein gesamtes Werk“ (S. 33) gefunden, kündigt er später in gesteigertem Überschwang beim renommierten Marineorchester Pola. Schließlich setzt er alle Hoffnungen auf seine in Leipzig uraufgeführte Kukuška, eine Art slawische Manon Lescaut, verkalkuliert sich dabei gründlich und kehrt zurück zur hier bei Frey endlich einmal informativer skizzierten Militärmusik. Am Pult des 26-er Infanterieregiments verschlägt es den im einschlägigen Tanzrepertoire kompositorisch Erfolgreichen erneut nach Wien. Hier wird „der Kampf um die Gunst des Publikums (…) zur zweiten Schule des Autodidakten Lehár.“ (S.44) Der Erfolg in diesem Kampf drängt ihn zur Operette. Zwar wird der 1901 seine Eigenart exponierende Walzer Gold und Silber für eine Redoute der Fürstin Metternich erst in Verlegerbesitz zum Welthit. Zum Glück aber hört bald eine Zwölfjährige am Eislaufplatz Lehárs Kapelle und präsentiert den feschen Kapellmeister als heißen Tipp ihrem Vater. Der wiederum war der führende Operettenlibrettist Victor Léon.
Auf dessen Text komponiert der nun freiberufliche Lehár den 1902 im Carl-Theater uraufgeführten Rastelbinder, den Frey unter Lehárs frühen Operetten (Erstling: Wiener Frauen am Theater an der Wien) als eine unkonventionell slawisch gefärbte Reform-Operette einstuft. Deutlich wird, dass die Erneuerung der um 1900 heurigenselig verflachten Wiener Operette kein Alleingang Lehárs wurde. Auch Victor Léon strebte nach emotionaler, psychologischer Vertiefung menschlicher Charaktere und Konflikte. Wiedererkennen konnte sich ein Wiener Publikum, das zu großen Teilen aus Zugezogenen bestand und ein gelungenes Beispiel für Assimilation an die Kaiserstadt erlebte. Und mit neuem Darstellungsstil nach Art des Grotesktanzes in der englischen Musical Comedy löste Louis Treumann Alexander Girardi an der Spitze der Wiener Operettenidole ab, leitete mit differenzierterer Körpersprache in Lehárs baldige Domäne der Tanzoperette über.
Treumann und Mizzi Günther kreierten 1905 im Theater an der Wien unter Direktion des auch verlegerisch einflussreichen Wilhelm Karczag das Traumpaar in Lehárs chef-d’oeuvre schlechthin: Die lustige Witwe. Dem stilistisch heterogenen Epochalwerk, das eine weltweite Konjunktur des modernisierten Genres Operette und eine Merchandising-Welle ungekannter Dimensionen auslöste, geht Frey auf über 40 Seiten nach. Überleitend zu allen Fragen der Werk- und Rezeptionsbelange incl. Vermarktung von Wien über London nach Amerika und weltweit, steht zentral der mentalitätsgeschichtliche Befund: Die durch globalisierten Handel entstandene Mittelschicht in den westlichen Industrieländern fand eine Projektionsfläche für verborgene erotische und emanzipatorische Sehnsüchte. Und im Dunstkreis von Freuds Psychoanalyse ist das Äußere Ausdruck einer inneren Gemengelage, die Danilo aus moralischen Gründen aktelang am Liebesgeständnis hindert.
Die Nachfolge der Lustigen Witwe bis zu „Lehárs Tristan“ (Analogien und Differenzen zu Wagner hier auch in sexuellen Konnotationen!) Endlich allein (1914) rubriziert Frey unter dem Motto „Der Zeit ihre Kunst! Operettenmoderne“. Neben den kritisch diskutierten Opernelementen etwa in Das Fürstenkind oder Zigeunerliebe landet der für die Lehársche Salonoperette exemplarische Graf von Luxemburg einen neuen Welterfolg. Nach persönlicher Art am Puls der Zeit zeigt sich Lehárs Operette auch im Umfeld des Ersten Weltkriegs, dem er ferner mit dem Zyklus Aus eiserner Zeit im ernsteren Liedgenre Rechnung trug. „Operettenfiguren spielen Tragödie“, wenn sich, so Frey, in Wo die Lerche singt der „Abschied vom bisherigen hedonistischen Operettenleichtsinn und die Hinwendung zum resignativen Verzichtschluss“ (S. 182) ankündigt. Die gelbe Jacke von 1923 – anders als in der Zweitfassung Das Land des Lächelns glückt die gewagte Liaison zwischen Wienerin und chinesischem Prinzen – zeigt dann, dass Lehár sich „endgültig in eine ästhetische Sackgasse manövriert“ (S. 213) hatte. Eine modisch tanzaffine Cloclo gerät 1924 ins Hintertreffen gegenüber Kálmáns Gräfin Mariza, die Lehárs inzwischen favorisierten Starinterpreten und Karczag-Nachfolger Hubert Marischka am Theater an der Wien zur Hochform auflaufen lässt. Dies jedoch leitet bereits „Das wahre Zeittheater“ ein – die vor allem vom neuen Operettenforum Berlin, u.a. dank der Gebrüder Fritz und Alfred Rotter, ausstrahlende Erfolgsserie der von Frey als „Lyrische Operette“ klassifizierten Spätwerke, überwiegend endend mit der tränenbewegten Trennung des Hauptpaars. Noch „zwischen Lehárs modernen Vorkriegsoperetten und den Lyrischen Operetten“ (S. 234) changierend, setzt Paganini 1925 den entscheidenden Wendepunkt, einen Wendepunkt auch für eine andere Zelebrität: den Operntenor Richard Tauber, den Lehár als seinen Idealinterpreten entdeckt hatte und an seinen noblen Domizilen in Bad Ischl und Wien zum Ausfeilen eigens dedizierter Bravourpartien willkommen hieß. Beifallsorkane beim institutionalisierten „Tauber-Lied“ im zweiten Akt von Der Zarewitsch, der Goethe-Romanze Friederike oder dem genannten Land des Lächelns arteten vom Kult zur Hysterie, ja zur „Ersatzreligion einer säkularen Warenwelt“ (S. 275) aus. Mitgewinner waren die neuen Medien Rundfunk, Tonfilm und Schallplatte. In die Hände spielte Lehár ein Vakuum, das nicht zuletzt Theodor W. Adorno sinngemäß auf „das mangelnde Interesse für Neue Musik und den gleichzeitigen maßlosen Konsum von Unterhaltungsmusik“ (S. 266) zurückführte.
Aufmerksam im Blick behält Frey permanent auch die privaten und geschäftlichen Verhältnisse (Tantiemenschlüssel, Rechtefragen, Verlagspraxis). Bereichern Aspekte von Lehárs enger Freundschaft mit Vorbild Giacomo Puccini auch dessen Gesamtbild um Lehár-Facetten, so gilt dies ungleich eindrücklicher für engere Bezugspersonen wie den Bruder Oberst Anton Freiherr von Lehár und Ehefrau Sophie. Deren Gefährdung als getaufte Jüdin hatte Lehár unterschätzt bis zum Zeitpunkt einer in letzter Minute verhinderten Deportation. Und jene brennende Frage, wie Lehárs eigene Einschätzungen und seine Rolle im Dritten Reich zu bewerten sind, beschäftigt Frey im Schlusskapitel „Lehár unterm Hakenkreuz“. Vorab interpretiert er gebührend und stoffgeschichtlich brillant die 1934 spektakulär an der Wiener Staatsoper herausgebrachte Giuditta als „Abschied der Operette von sich selbst“: Nach der Operntravestie bei Offenbach, „entstanden aus dem schlechten Gewissen ernster Musik, travestierte in Giuditta Operette schließlich zur Oper: das schlechte Gewissen der leichten Musik ereilt sich selbst.“ (S. 306) Und überkreuz mit seiner erträumten Operetten-Veredlung erfuhr Lehárs Frühwerk eine Frischzellenkur in revuehaften Bearbeitungen für Fritzi Massary oder den neuen frackbewehrten Parade-Danilo Johannes Heesters. Im übrigen Kapitelverlauf dominieren dagegen biographische Einzelereignisse im Spannungsfeld der politischen Verhältnisse: ein anstrengender Prozess gegen Schweigegelderpressung (Betreff: mutmaßlicher Kontakt zu einer Vermittlung „leichter Mädchen“), überwiegend aber diverse Kontakte und Szenen im NS-Kontext bis hin zu persönlichen Begegnungen mit Hitler und Goebbels. Belege für Anbiederungen und Naivität im Hinblick auf Wertschätzung durch die NS-Kulturpolitik stehen neben persönlichem Einsatz für bedrohte jüdische Kollegen. Das „zweifellos düsterste Kapitel in der sich immer mehr verdüsternden Biographie Franz Lehárs“ nennt Frey den Fall des prominenten Liedtexters und Librettisten Fritz Löhner-Beda, der bis zuletzt in Auschwitz auf Lehárs Fürsprache hoffte. Ein zitierter, nicht definitiv verifizierbarer Bericht spricht von einer Reise zum Führer, der die georderte Akte des Nazigegners vermutlich indifferent beiseitegelegt haben dürfte. Frey: „Um ihn tatsächlich zu retten, hätte Lehár zweifellos mehr riskieren müssen.“ „Dass Lehár“, so Freys Resümee gleich im Anschluss, „der nationalsozialistischen Ideologie ferne stand, ist vielfach belegt. Dass er sich für sie vereinnahmen ließ, ist aber genauso offensichtlich.“ (S. 343) Entsprechend lasten anklagende „Schatten der Vergangenheit“ (S. 348) über den wenigen Nachkriegsjahren des letzten wahrhaftigen Operettenkönigs.
Andreas Vollberg
Köln, 29.08.2020
