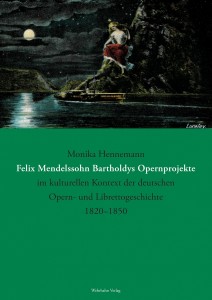 Monika Hennemann: Felix Mendelssohn Bartholdys Opernprojekte im kulturellen Kontext der deutschen Opern- und Librettogeschichte 1820‑1850. – Hannover: Wehrhahn, 2020 – 725 S.: Abb., Notenbeisp.
Monika Hennemann: Felix Mendelssohn Bartholdys Opernprojekte im kulturellen Kontext der deutschen Opern- und Librettogeschichte 1820‑1850. – Hannover: Wehrhahn, 2020 – 725 S.: Abb., Notenbeisp.
ISBN 978-3-86525-682-9 : 48,00 € (geb.)
Felix Mendelssohn und die Oper – das ist ein bisher wenig beachtetes aber brisantes Thema und bleibt es auch nach diesem Buch von Monika Hennemann, einer multidisziplinär arbeitenden Geisteswissenschaftlerin, mit dem sie sich vor zehn Jahren in Deutschland promovieren ließ, um dann im angloamerikanischen Wissenschaftsbetrieb tätig zu sein. Das große Rätsel, warum es Mendelssohn nach seinen sechs Jugendopern nicht gelang, eine von ihm stets angestrebte große Oper zu schreiben, wird in dieser Untersuchung nicht gelöst, sondern mit einem großen Aufwand des Erforschens von Primär- und Sekundärquellen weitschweifig beschrieben. Dass Mendelssohn generell und in jedem konkreten Fall unter den der Gattung Oper innewohnenden Divergenzen zwischen Text, Handlung und Musik litt und sie nicht von der Musik her skrupellos in eine lyrisch-dramatisch-epische Einheit zwingen konnte, kommt nicht in den Blick. Zwar gelingt es der Autorin, diese Fragestellung in vielfältigen Aspekten aus der Lebens- und Werkgeschichte Mendelssohns unter Berücksichtigung weiterer kultureller Zeitumstände zu entwickeln, aber letztlich steht sie sich bei ihrer Fleißarbeit und ihren Schlussfolgerungen durch etliche vorausgesetzte Maximen selbst im Wege. Diese axiomatischen Voraussetzungen sind allerdings nicht von ihr entwickelt worden, sondern sie hat sie aus dem vorhandenen Hauptstrom der deutschen Operngeschichtsschreibung übernommen und wendet sie quasi nur an. Dankenswerterweise legt sie diese Axiome oder Generalannahmen gleich in den grundlegenden Kapiteln offen, sodass es relativ leicht möglich ist, diese Fehlkonstruktion zu erkennen.
Hennemann geht davon aus, dass zwischen Webers Oberon und Wagners Lohengrin (zufällig ungefähr die Zeitspanne zwischen Mendelssohns Hochzeit des Chamacho und seinem Loreley-Fragment, also den zwanzig Jahren zwischen 1827 und 1847) eine „Krise der deutschen romantischen Oper“ (S. 23) bestanden hätte. Das ist nur eine Fortsetzung der Legende von einer Lücke in der deutschen Operngeschichte zwischen Beethovens Fidelio und Webers Freischütz. Wie viele Namen und Opern muss man ignorieren und verschweigen, um diese Lücken oder Krisen wahrzunehmen! Wenn man beispielsweise Franz Danzis Opern mit vielen anderen Werken, die langsam aus der Versenkung wieder auftauchen, heute hört, will man an solch eine in der Musikgeschichtsschreibung behauptete „Lücke“ gar nicht mehr glauben und fängt an, sich ein Repertoire einer frühromantischen deutschen Oper der ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts zusammenzustellen, das es real so wohl nicht gab, aber – hätten es die damaligen opernfreudigen Zeitgenossen Danzis und Webers und Spohrs und Hoffmanns und Marschners und Lortzings und vor allem die Operndirektoren nur gewollt – so hätte geben können. Dass auch die heutigen Operndirektoren von diesem verborgenen Repertoire nichts wissen wollen und selbst die wenigen Erfolgsopern der damaligen Zeit auf den aktuellen ausgedünnten Spielplänen nicht zu finden sind, scheint Hennemann und den anderen zünftigen Opernhistorikern Recht zu geben. Also bleibt es bei der deutschen Oper bei: 1 x Beethoven, wenig Weber, viel Wagner, basta.
Deutschtum und Romantik in der Opernproduktion werden von Hennemann mit dem Inferioritätsgefühl der verspäteten deutschen Komponisten gegenüber dem glücklich verwirklichten „Einheitsgefühl“ der italienischen und französischen Opernkultur in eine spannungsreiche Beziehung gesetzt. Es ist die Crux jeglicher Gattungsästhetik, dass sie von einem einheitlichen Muster dessen ausgeht, was die Gattung jeweils ausmachen soll. Davon, dass es eine beneidenswerte, nachzuahmende, einzuholende, in sich einheitliche italienische oder französische Operngattung gegeben hätte, kann aber gar keine Rede sein. Im Gegenteil fragt man sich, wie es in Italien, obwohl auch dieses Land noch zu keiner Nation vereinigt war, an so vielen Orten und Regionen zu so vielen unterschiedlichen Opernformen kommen konnte, die nur unter dem zweifelhaften Sammelbegriff einer „italienischen Oper“ zusammengefasst sind. Von den französischen Querelles die Oper betreffend ganz zu schweigen. Und keiner weiß zu sagen, wie die heiß ersehnte „deutsche romantische Oper“ eigentlich hätte aussehen sollen. Auch Hennemann gibt sich damit zufrieden, dass sie „mit deutschem Libretto und deutscher Musik“ (S. 30) hätte ausgestattet sein müssen und darüber hinaus all die Qualitäten hätte aufweisen müssen, die C. M. von Weber, Louis Spohr, E.T.A. Hoffmann und Friedrich Rochlitz sich von ihr wünschten, nämlich: wahr, intellektuell, eigentümlich, tief, gehaltvoll, zu einem schönen Ganzen (des Zusammenwirkens aller Künste) gerundet ‑ natürlich im Gegensatz zu den oberflächlichen welschen Produkten.
Zudem wird dieses Opernideal abwegiger Weise nicht nur mit den politischen deutschen Einheitsgedanken verknüpft, sondern Hennemann findet, dass „eine direkte Verbindung zwischen dem Streben nach nationalem Bewusstsein und den Entwicklungen in der Gattung Oper, die diesem Streben Ausdruck verleihen sollte, nahe liegt“ (S. 29). Es ist die bekannte Konstruktion, dass die deutsche Oper zur ideellen und schließlich realen nationalen Identitätsfindung der Deutschen hätte beitragen sollen – bekannt aber erst, seit Richard Wagner dieses künstlerisch-politische Junktim in die Welt gesetzt hat und es bis heute als das beherrschende Problem der deutschen Operngeschichte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nachgebetet wird. Selbstredend hat sich dieses Problem dann durch das musikalische Drama Wagners und die erfolgte Reichsgründung in Wohlgefallen aufgelöst. Der Gedanke ist also so wenig originell wie falsch, weil er an der seit Mozarts Experimenten mit deutschen Opernformen (die bei Hennemann nicht vorkommen) buntscheckigen Wirklichkeit der deutschen Operngeschichte vorbeigeht und so tut, als sei erst mit Wagners Lohengrin eine angebliche Krise (die nur fiktiv herbeigeredet ist) gelöst worden. Man kann eine musikdramatische Sendung Wagners nur postulieren, wenn man die deutsche Opernwirklichkeit vor Wagner (die von Weber, Danzi, Knecht, Spohr, Marschner, Lortzing, Kreutzer, von Flotow und anderen) kleinredet und als minderwertig oder krisenhaft hinstellt, weil sie das Problem der Oper noch nicht gelöst hätte. Das wirkliche Problem der Oper aber liegt an ihrer unüberwindlichen inneren Widersprüchlichkeit, aus Handlung, Wort, Musik und Bild zusammengesetzt zu sein, woraus es keine Erlösung gibt, schon gar nicht durch das Wagnersche gesamtkünstlerische Bühnen(weih)festspiel, in dem angeblich die widerstrebenden Elemente nach dem Oberkommando eines übergeordneten entdramatisierten metaphysischen Dramas harmonisch sollen zusammenfinden können. Nach Hennemann seien Mendelssohns Opernprojekte von jenen Problemen beherrscht gewesen, die sie lediglich von Wagners späteren Thesen her rückwärts in sie hineinprojiziert. Mendelssohn aber hatte eine Oper nach Sinn und Geschmack seiner genannten Zeitgenossen schreiben wollen, ohne das in sich spannungsgeladene Konstrukt der Oper überwinden zu wollen.
Außer den großen konzeptuellen gibt es auch einige kleinere, nicht zu verachtende Mängel oder Schnitzer in diesem Buch. Bedauernd stellt Hennemann auf S. 32 kurz fest, dass Mendelssohn in seiner Düsseldorfer Zeit als Musikdirektor am Theater „keine eigene Oper inszeniert“ habe. Das sei auch nicht seine Aufgabe gewesen angesichts der Arbeitsteilung zwischen ihm und Karl Immermann als inszenierendem Intendanten und den Bühnenbildnern. Gemeint ist wohl die Tatsache, dass Mendelssohn die Komposition des von Immermann vorgelegten Librettos zu einer Oper Der Sturm nach Shakespeare (eines Opernauftrags aus München, es ist im Anhang des Buches auf 35 Seiten abgedruckt) während der Düsseldorfer Jahre nicht in Angriff nahm, was in dem dieser Zeit gewidmeten ausführlichen Kapitel anhand der Primärdokumente (Immermanns Erinnerungen und Briefen Mendelssohns) präzise entfaltet wird. Mendelssohn konnte sich mit diesem Libretto nicht anfreunden. Seltsam ist, dass in diesem Zusammenhang eine der zeitgenössischen Opern, die Mendelssohn dort dirigiert hatte ‑ Marschners Der Templer und die Jüdin ‑ nicht erwähnt wird, ebenso wenig wie die kleineren Schauspielmusiken (immerhin bühnenmusikalische Vorformen ausgewachsener Opern) zu Stücken von Immermann, die er dort komponierte und aufführte. Dafür wird anhand einer großen Zahl von Dokumenten erstmalig das Zerwürfnis zwischen den beiden ungleichen Charakteren subtil geschildert und verständlich gemacht. Mendelssohns Einblicke in die Maschinerie eines Opernbetriebs waren wohl eher abschreckend und ließen ihn hilflos taktierend zurück.
Da Mendelssohn in seinen Opernplänen an den Libretti scheiterte, tut Hennemann gut daran, sich den Librettisten, mit denen Mendelssohn zu tun hatte, und ihren Entwürfen näher zu widmen. Hier kann von einer systematischen Aufarbeitung der im Anhang aufgelisteten 123 Opernprojekte oder -phantasien, mit denen Mendelssohn sich herumschlug, gesprochen werden. Genauer wird das Pervonte-Projekt mit seinem Freund Klingemann behandelt, wozu Regina Back unerlässliche Vorarbeiten geliefert hat. Dieses auf S. 252 beginnende und sich über 300 Seiten hinziehende Herzstück der vor zehn Jahren in Mainz eingereichten Dissertationsschrift ist eine wahre Materialschlacht, die entlang der verschiedenen Kategorien von Librettisten („Freunde“, „Schreiberlinge und Karrieristen“, „Berufsdichter und ‑librettisten“) abgearbeitet wird und die eigentliche und positive Substanz dieses Buches ausmacht. Hier werden auch die französischen und für besonders vielversprechend gehaltenen englischen Opernprojekte vorgestellt. Hier kann sich informieren und davon zehren, wer es genau wissen will. Dieser große Abschnitt mündet in eine Darstellung und Beurteilung des letzten Opernprojekts Mendelssohns, das er als ein von seiner zehnten England-Reise physisch erschöpfter und durch den Tod seiner geliebten Schwester Fanny psychisch gebrochener Komponist in den letzten Lebensmonaten endlich wieder anpackte, Die Loreley.
Zwar macht Hennemann unfreiwillig aufgrund ihrer breit angelegten Auswertung des gesamten Briefwechsels zwischen Mendelssohn und dem Dichter Emanuel Geibel plausibel, dass bei dieser zermürbenden Prozedur auch dieser am weitesten gediehene fragmentarische Opernversuch wegen der dramaturgischen Mängel des Librettos nicht die große Oper hätte werden können, von der Mendelssohn träumte, kommt aber nach einer positiven musikalischen Bewertung der überlieferten Fragmente zu dem gegenteiligen Schluss, dass bei „der musikalischen Inspiration, die aus den komponierten Passagen trotz seiner angeblichen Unzufriedenheit mit der inhaltlichen Seites des Textes spricht, es schwer fällt zu glauben, dass er die Komposition nicht mit ähnlich großem Erfolg weitergeführt und beendet hätte“ (S. 542). Ein unredliches und vergiftetes Kompliment, wenn man bedenkt, dass die Autorin zuvor konstatiert hatte, Mendelssohn habe sich gegenüber seinen jugendlichen Opernkompositionen nicht weiterentwickelt und stünde als Opernkomponist zu Mozart, Schubert und Weber in einem epigonalen, wenn nicht minderwertigen Verhältnis.
In dem historisch referierenden und interpretierenden Kernstück des Buches enden auch die mühseligen, aber heute zur wissenschaftlichen Mode gewordenen sogenannten Kontextualisierungen, bei denen das Kontextualisierte unter seinen Kontexten zu verschwinden droht. Die dem Hauptkapitel vorhergehenden Kontextualisierungen befassen sich mit Mendelssohns früher Berliner Zeit; hier erfolgt die übliche Überschätzung Zelters und Abwertung Ludwig Bergers, wobei einerseits Mendelssohns von Berger beeinflusste frühe Klavier- und Kammermusik, andererseits dessen Liederspiel Die schöne Müllerin mehr Beachtung verdient hätten und sie das negative Urteil hätte revidieren können. Außerdem mit Mendelssohns späterer Berliner Zeit und den ihm aufgedrungenen Antikenprojekten (hier erfolgt die übliche Abwertung von Ödipus in Kolonos und Athalia gegenüber Antigone) sowie mit seinen wachsend opernhaften Oratorien in ihrem Verhältnis zur eigentlichen Oper. Die Wechselbeziehungen von Mendelssohns Schauspielmusiken und Oratorien zur eigentlichen Opernsphäre sind unbedingt bedenkenswert, müssten dann aber weniger von den Libretti als vom immanent Musikalischen her untersucht werden, wozu Hennemann sich nicht aufrafft. Eine besondere Nähe zur Opernsphäre hatte Mendelssohns Schauspielmusik zu Shakespeares Ein Sommernachtstraum, wo er mit szenisch eingeflochtenen Arien, Melodramen und Chören experimentiert, was Hennemann aber nicht zu den diskutierenswerten Kontexten zählt. Eine weiterhin eingeschaltete vierzigseitige Auseinandersetzung mit „Biographien und wissenschaftlicher Sekundärliteratur“ zu Mendelssohn als Opernkomponist übergeht, obwohl das Buch aktualisiert sein soll, jüngere anscheinend belanglose deutschsprachige Beiträge.
Nur nebenbei bemerkt gibt es eine falsche Jahreszahl im Personenverzeichnis, wo für die ganze Familie Mendelssohn, den Vater Abraham, die Mutter Lea und die Kinder Fanny, Felix, Rebekka und Paul als das Jahr, seit dem sie zusätzlich Bartholdy hießen, 1816 angegeben wird. 1816 war aber nur das Jahr, in dem Felix und Fanny im reformierten Bekenntnis getauft wurden, ohne dass ihr Name geändert worden wäre. Die Namensänderung durch das die Taufe anzeigende Anhängsel Bartholdy für alle Familienmitglieder wurde erst anlässlich der Taufe der Eltern im Jahre 1822 vorgenommen, da war Felix 13 Jahre alt. Bartholdy war also weder der Geburts- noch der angehängte Taufname von Felix Mendelssohn. Die Autorin weiß das sehr gut, denn sie schreibt es selbst auf Seite 18 und teilt, allerdings ohne es zu begründen, mit, dass sie den Zweitnamen nicht verwenden wird, wofür es tatsächlich gute Gründe gibt. In dem angloamerikanischen Umfeld, in dem die Autorin lebt, ist dies eh üblicher als in Deutschland, wo um diese Frage meist prinzipialistisch gestritten wird, dazu sind zu viele seiner Anhänger deutsche Protestanten, die sich ihren Bartholdy nicht rauben lassen wollen.
Zutreffend entwickelt Hennemann eine Mendelssohn eigene Opernästhetik, wie sie aus seinen fertigen bühnenmusikalischen Produkten (den sechs Jugendopern, die hier nicht eigens besprochen werden), den brieflichen Äußerungen und dem Fragment Die Loreley rekonstruierbar ist. Allerdings bezieht sie sich dabei überwiegend auf Fragen der ästhetisch-moralischen Eigenschaften der Sujets und Protagonisten. Man müsste zudem hierbei berücksichtigen, dass sich Mendelssohn dabei all der musikalischen Errungenschaften bediente, die tendenziell auch bei seinen Zeitgenossen im Schwange waren: weg vom Schreckgespenst der Nummernoper, hin zu einer durchkomponierten Faktur mit Erinnerungs- oder Leitmotiven, Chromatisierung der Harmonik, Sprechgesang. Und würde dann zu dem Ergebnis kommen, dass Wagner keine neue Epoche der Oper eröffnet hat, sondern diese nicht von, sondern vor ihm entwickelte Techniken nur verabsolutierte, übertrieb und zu Tode ritt, und zwar unter musikphilosophischen Prämissen, die Mendelssohn nie und nimmer geteilt hätte.
Gut möglich, dass die nun endlich gedruckte deutschsprachige Doktorarbeit in dem avancierten angloamerikanischen Milieu der Mendelssohn-Forschung, in dem die Autorin seit längerem lebt und aus dessen Perspektive viele ihrer Betrachtungen angestellt wurden, als ein weiterer beachtlicher Fortschritt angesehen wird – ob dieses Buch in Deutschland, wo eine vorurteilsfreie Rezeption Mendelssohns für immer verloren scheint, etwas Positives ausrichten kann, ist zweifelhaft, da sich die Autorin, gestützt auf abstrakte Werturteile, vielen dieser historisch untermauerten Vorurteilen anschließt und genau zu wissen meint, welche Aspekte man bei Mendelssohn vernachlässigen darf.
Peter Sühring
Bornheim, 18.04.2020
