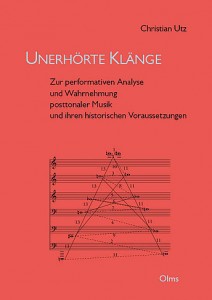 Christian Utz: Unerhörte Klänge. Zur performa-tiven Analyse und Wahrnehmung posttonaler Musik und ihren historischen Voraussetzungen - Baden-Baden: Olms, 2023. – 490 S.: s/w-Abb. u. Notenbsp. (Studien und Materialien zur Musikwissenschaft ; 125)
Christian Utz: Unerhörte Klänge. Zur performa-tiven Analyse und Wahrnehmung posttonaler Musik und ihren historischen Voraussetzungen - Baden-Baden: Olms, 2023. – 490 S.: s/w-Abb. u. Notenbsp. (Studien und Materialien zur Musikwissenschaft ; 125)
ISBN 978-3-487-16330-7 : € 69,00 (kart.; auch als eBook)
Dass verschiedenartige Musik unterschiedliche Hörhaltungen einfordert, hat Adorno in seinen musiksoziologischen Schriften, unter anderem als ein Ergebnis seines USA-Aufenthalts in den späten 1930er und 1940er Jahren, grundlegend nachgewiesen. Von Wertungen konnte er sich nicht freihalten, im Gegenteil, er brauchte sie, um das Populäre gegen das Unpopuläre, um leichte gegen komplexe Musik auszuspielen, denn von anderer Warte, von Friedrich Blume etwa, wurde zur selben Zeit das angeblich Naturgegebene gegen das vermeintlich Konstruierte in Stellung gebracht. Die Vorstellung hiervon geistert immer noch bzw. im Zuge eines erstarkenden Kulturkonservativismus erneut durch die Feuilletons, dabei außer Acht lassend, dass jede Musik ihr eigenes Hören erfordert: Die Hörhaltung im Bierzelt oder im Fußballstadion ist eine andere als bei der Aufführung eines Nonoschen oder Feldmanschen Spätwerks.
Dies ist der Ausgangspunkt (bzw. einer von zahlreichen) des an der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz und an der Universität Wien lehrenden Musikwissenschaftlers, Musiktheoretikers und Komponisten Christian Utz. Sein Ansatz ist es, den Komplex von Analyse und Wahrnehmung posttonaler Musik aus dem Verstehen neuer Musik in Analogien zu vergleichbaren Phänomenen alter Musik zu kategorisieren. Er geht damit über bisherige Wahrnehmungstheorien hinaus: Schlüsselbegriffe sind Morphologie (Gestalt) und Syntax (Zeitgefüge). Utz beklagt den konservativen Stand gegenwärtiger Musikwissenschaft, der es kaum mehr gelinge, den veränderten Hör- und Rezeptionsgewohnheiten und deren Brüchen gerecht zu werden, wenn sie über die Analyse des Notentextes nicht hinausgeht. Auch wenn in den letzten Jahren die Zahl an Forschungsarbeiten zur Wahrnehmungsästhetik und performativer Analyse – häufig auch mit soziologischem Schwerpunkt – regelrecht explodiert ist, beeinträchtigt und tangiert dies den Rang der vorliegenden Arbeit in keiner Weise, denn in vielen dieser Publikationen spielen die zu betrachtenden Werke nur die „zweite Geige“, ganz abgesehen von den zumeist wenig ergiebigen Höranalysen (wenn es denn überhaupt einmal um konkrete Beispiele geht).
Die historische Entwicklung einer Veränderung der Hörwahrnehmung kann nicht ignoriert werden: Selbst ein geübter Hörer, ein Expertenhörer, dürfte heute kaum in der Lage sein, jenen Akkord in Schönbergs Verklärter Nacht ohne Partitur als Regelverletzung zu identifizieren, der 1902 zu einem Skandal führte. Erst nach und nach wurde es als Selbstverständlichkeit angesehen, dass jede Musik eigene Wahrnehmungsstrategien erfordert. Alles Neue wird zunächst mit den Maßstäben des Alten gehört und missverstanden, selbst Dahlhaus, auch Adorno, wollten sich nur bedingt dazu bekennen.
Die wachsenden Höranforderungen der Musik nach 1950 hat etliche Komponisten dazu gebracht, Höranleitungen für ihre Musik zu publizieren; Helmut Lachenmanns Hörtypologie von Klanggestalten „Klangtypen der Neuen Musik“ von 1966 sowie Stockhausens „Anleitung zum Hören“ von 1955 oder „Die Kunst zu hören“ (1980) sind gewissermaßen Urahnen der vorliegenden Arbeit.
Utz präsentiert zwei Schlüsselbegriffe, Morphologie und Syntax, denen jeweils das zweite und dritte Hauptkapitel des Buches gewidmet sind. Die Verknüpfung beider Begriffe führt das Gestalthafte, den Klang (quasi die Wortform), mit dem Zeitgefüge (den Wortfolgen) zusammen, was im Klang-Zeit-Raum, einer sich in Zeit und Raum entfaltenden Musik mündet.
In einem ersten Teil des Buches werden die historischen und methodischen Grundlagen für den Themenkomplex präsentiert und aufgearbeitet. Da die Lektüre dieses theoretischen Abschnitts den Leser in einem anderen Maße fordert als die weiteren Kapitel, bietet es sich durchaus an, diesen Teil ans Ende der Lektüre zu stellen.
Die beiden, wenn man so will, praktischen Kapitel sind deutlich zugänglicher und für diejenigen Leser, die die jeweilige Musik in den Ohren oder vor den Augen haben, leicht verständlich nachvollziehbar. Der Autor geht über den selbstgewählten Rahmen einer nichttonalen Musik gelegentlich hinaus, wenn er etwa das imprévu in Schuberts Sinfonie h-Moll, der „Unvollendeten“, als das Nicht-Voraushörbare als Thema musikalischer Erwartung in seine Analysen einbezieht. Anhand dieses sehr plastischen Beispiels stellt sich die Frage, welche Konstruktion eines Idealhörers hier gemeint ist, wenn der Wiederholungshörer doch anderes gewahr wird als der Ersthörer? Für Adorno etwa waren Struktur und Wahrnehmung noch unauflösbare Gegensätze, heute werden sie als Gegenstand der Wahrnehmung aufgefasst (S. 34).
Der pluralistische Ansatz eines Entwurfs einer Theorie posttonaler Musik zielt auf die Überwindung der Autorintention, zumal die charismatischen Persönlichkeiten der Neuen Musik allesamt eine Deutungshoheit ihres Musikverständnisses vorlegten – auch dies eine Abkehr vom biographisch geprägten Ansatz früherer musikwissenschaftlicher Gewissheiten. Spannend wird dies dann, wenn konnotative Elemente ins Spiel kommen, denn gerade sie sind doch Ausdruck von Autorintention. Wie sonst sind etwa bei Lachenmann die auratisch aufgeladenen Klänge zu verstehen und im Gegensatz dazu die gänzlich ich- und kontextbefreiten Klänge bei Cage? (Und in diesem Zusammenhang wäre noch zu fragen, wie mit den hier entwickelten Fragestellungen eine Musik, die der Schriftlichkeit entbehrt – elektronische Musik oder Improvisation – in den Griff zu bekommen ist).
Hier kommt der vor ca. 20 Jahren aufgekommene Begriff der „Welthaltigkeit“ ins Spiel; Utz führt als Beispiel die Pistolenschüsse in Lachenmanns Schlagzeugkonzert Air an, die ohne einen konkreten Zeitbezug nicht denkbar sind – und so nicht hätten komponiert werden können.
Die analysierten Beispiele werden auf sehr unterschiedliche Aspekte hin untersucht, etwa Tonverbindungen in Schönbergs Klavierstück op. 11 Nr. 3 und in Boulez‘ Structures Ia für zwei Klaviere, die jeweils als Hörklammern wahrgenommen werden können. Sehr viel schwerer greifbar wird dies bei der, nach Aussage des Autors, als unanalysierbar geltenden Musik von Varèse oder Scelsi. Interessant in diesem Zusammenhang ist die Frage, mit welchem Instrumentarium man dann beispielsweise dem Atlas eclipticalis von Cage gerecht zu werden vermag, wo musikalischer Zusammenhang mindestens auf der Produktionsebene eliminiert wurde. Was ist da zu hören?
Manche Beispiele im 3. Teil des Buches werden ein wenig pauschal abgehandelt, die Werke von Bernd Alois Zimmermann und Brian Ferneyhough etwa. Als Glanz- und Höhepunkt des Buches erweisen sich dann aber die Kapitel zur Musik von Lachenmann, in der der Wahrnehmungsaspekt ein zentraler Bestandteil der Musik ist. Besonders die Analyse des Cellostückes Pression ist fundiert und ergiebig, weil hier mehrere Analyseaspekte vereint sind und neben der Partitur auch CD-Einspielungen berücksichtigt werden. Doch auch die Ausführungen zu Salvatore Sciarrinos Formdenken (und Schlussbildung) sind in ihrer dichten Bildhaftigkeit ein großer Gewinn für die Lektüre.
Das Buch ist nicht als Einzelstudie konzipiert worden, sondern Resultat einer jahrelangen Forschungsarbeit, wie der Autor im Nachwort schreibt. Mehr als 30 Einzelpublikationen sind in diese profunde Arbeit eingeflossen, der man wünscht, dass sie von der Musikwissenschaft angemessen zur Kenntnis genommen und gewürdigt wird.
Rüdiger Albrecht
Berlin, 12.6.2024
