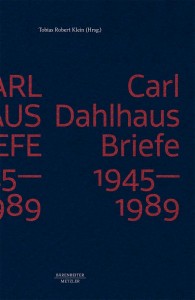 Carl Dahlhaus. Briefe 1945-1989 / Hrsg. von Tobias Robert Klein. – Kassel: Bärenreiter/Metzler, 2022. – 704 S.
Carl Dahlhaus. Briefe 1945-1989 / Hrsg. von Tobias Robert Klein. – Kassel: Bärenreiter/Metzler, 2022. – 704 S.
ISBN 978-3-662-64667-0 : € 139,99 (geb.)
Briefe eines Musikwissenschaftlers zu veröffentlichen, ist durchaus ungewöhnlich. Dass gerade Carl Dahlhaus nun diese Ehre zuteilwird, ist kaum überraschend, denn die Strahlkraft seines Denkens hinterlässt im akademischen Diskurs ihre Spuren bis heute – anders als bei etlichen Zeitgenossen seiner Zunft. Warum das so ist, liegt nicht nur an der gedanklichen Tiefe und an der sprachlichen Brillanz seiner Arbeiten, auch die Breite und Vielfalt seiner Themen und Forschungsgebiete spielt eine Rolle, schließlich der beeindruckende Umfang seines schriftstellerischen Werks. Es nimmt kaum Wunder, dass sich die Begegnung mit Theodor W. Adorno anfangs der 1950er Jahre als ein Schlüsselerlebnis für Dahlhaus erweisen sollte, als die vielleicht wichtigste – und zeit seines Lebens einzige – Referenz. Dabei war der Kontakt des ganz jungen Dahlhaus zu dem damals bereits in seinem Zenit stehenden Vorbild keineswegs ungetrübt, Adornos Idiosynkrasie gegenüber Kritik stand von Anbeginn an im Raum. Dahlhaus erweist sich hier als der souveräne und zugleich Distanz respektierende Briefpartner, wie man in diesem sehr sorgfältig erarbeiteten und lektorierten Buch erfährt.
Das Buch ist in zwei Hauptteile gegliedert: Auf 359 Briefe an unterschiedliche Adressaten folgt ein zweiter Teil, vom Herausgeber Tobias Robert Klein, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Berliner Humboldt-Universität, mit „Notizen“ überschrieben. Es sind Exzerpte von Briefen an die Ehefrau, Annemarie Dahlhaus, aus den Jahren 1949 bis 1968, von ihr ausgewählt und bereinigt, sowie in weitaus größerem Umfang Auszüge aus Briefen an Sigrid Wiesmann, die Dahlhaus 1978 am Forschungsinstitut für Musiktheater der Universität Bayreuth kennenlernte, wo sie als Mitarbeiterin tätig und er zur selben Zeit mit Vorarbeiten zur Wagner-Gesamtausgabe betreut war. Diese Briefexzerpte reichen von 1978 bis 1988, und es sind zweifellos die am spannendsten zu lesenden Briefe dieser Edition. Klein spricht in seinem Nachwort Mühen und Unzahl schwer abzuwägender Entscheidungen an, die, bedingt etwa durch die Berücksichtigung von Persönlichkeitsrechten der zum Teil noch lebenden Briefpartner oder namentlich Genannten, notwendig waren. Warum gerade die Briefe an Sigrid Wiesmann Eingang in das Buch gefunden haben, begründet der Herausgeber nicht – Vermutungen hierzu bleiben Spekulation –, denn immerhin, so Klein, sind von Dahlhaus allein aus den Jahren ab 1966 mehrere (!) 10.000 Briefe überliefert. Dass Dahlhaus 1959 beklagt, das Briefeschreiben falle ihm schwer, auch wenn man meinen sollte, „die Gewohnheit des Publizierens mache das Schreiben leichter“ (S. 27, Anm. 1), entbehrt nicht, angesichts des gigantischen Briefkonvoluts, das neben dem nicht minder umfangreichen schriftstellerischen Werk entstanden ist, eines gerüttelt Maßes an Ironie.
Der heikle Balanceakt des Auswählens betraf nicht nur die Rechte von Lebenden bzw. von Rechtsnachfolgern, sondern auch den Umgang mit Privatem, der nicht in allen Fällen vermieden werden konnte oder sollte. Die Briefe sind, wohl um den Text- und Lesefluss nicht allzu sehr zu behindern, ohne Auslassungszeichen versehen, so dass leider nicht ersichtlich wird, inwieweit bzw. ob überhaupt die ausgewählten Briefe jeweils vollständig wiedergegeben werden und an welchen Stellen gestrichen wurde. Warum Klein auf dieses für wissenschaftliche Briefausgaben unerlässliche Editionsprinzip – und auf weitere Hinweise zur Textgestalt, Seitenumbrüchen etwa – verzichtet hat, wird von ihm nicht erläutert; die Streichungen selbst werden in den Editionsprinzipien (S. 681) kommentiert.
Gerade in den Briefen an Wiesmann tritt beim Lesen der Charakter der privaten Mitteilung zurück, die Person der Adressatin bleibt schemenhaft verborgen; vielmehr entsteht der Eindruck eines Tagebuch-Schreibens, nicht als auktoriale Erinnerungsstütze, sondern als Nachricht an einen imaginären Leser, durchaus im Hinblick auf eine Veröffentlichung. Belanglosigkeiten, Alltägliches und sprachliche Nachlässigkeiten finden sich nirgendwo in diesen Briefen, die Fülle an Beobachtungen und deren Einordnung gehen einher mit sprachlicher Brillanz.
Der zweite Teil des Buches verhält sich zum ersten Teil wie eine Innenansicht zur Außenansicht, wie das Private zum Öffentlichen. Der erste Teil beinhaltet gewissermaßen die geschäftliche Korrespondenz, deren Adressaten zum großen Teil Musikwissenschaftler sind, daneben Verleger, Komponisten, Literatur- und Theaterwissenschaftler. Dahlhaus, der Ende der 1940er bis Anfang der 1950er Jahre in Göttingen zusammen mit Rudolf Stephan, genannt Michael, Joachim „Jochen“ Kaiser und anderen später namhaft gewordenen Musikwissenschaftlern studiert hatte, baut sich ein dichtes Netzwerk innerhalb der akademischen Zirkel auf, die Briefe zeugen von seinem diplomatischen Geschick, das er in späteren Jahren gelegentlich, um Projekte nicht zu gefährden, durchaus auch einmal preisgeben konnte. Eingedenk des hier zumeist zielgerichteten und nicht reflexiven, bewertenden Kommunikationsaktes fällt es schwer, den Menschen Dahlhaus hinter dessen Maskierung zu erkennen, denn, wie er einmal schreibt, „die milde Kritik (wirke) wie die Maskierung einer scharfen, die man nicht äußern mag“ (S. 190). Nicht selten werden den „milden“ Äußerungen des ersten Teils im zweiten die „Masken“ abgerissen. Und dennoch entfaltet sich bereits im ersten Teil des Buches ein Panorama der musikwissenschaftlichen Szene der Nachkriegsjahrzehnte, die von der Auflehnung der damals jungen Generation um Dahlhaus und Rudolf Stephan gegen ihre in der NS-Zeit sozialisierten Vorgänger in den Ordinariaten berichten wie von der Neudefinition des Fachs Musikwissenschaft, das sich bis dato in der Hauptsache auf Volksliedforschung und Mittelalterforschung beschränkt hatte.
Wie ein roter Faden zieht sich die Arbeit an diversen Großprojekten, die immer wieder am Rand des Scheiterns standen, durch das Buch: an erster Stelle die Wagner-Gesamtausgabe, inklusive Schriften, Briefen, Ikonografie und Werkverzeichnis, die sich durch die oft konträren, gar gegenseitig ausschließenden Interessen des Teams als ein Kraftakt ungeahnten Ausmaßes auswuchs. Wiederholt bezeugt Dahlhaus, in Zukunft sich solch nervenaufreibender Teamarbeit nicht mehr aussetzen zu wollen, zumal auch er sich der Kritik von Kollegen stellen musste (S. 164 Anm. 2).
Gelegentlich, zumindest in der vorliegenden Auswahl, verliert auch der sonst so überaus kontrollierte Diplomat seine Contenance, wenn es etwa um seiner Meinung nach „pseudopolitische“ Aktionen geht: Frieder Reininghaus tut sich dann in Darmstadt 1974 als „unser gemeinsamer Sargnagel“ (S. 233) hervor und Reinhard Oehlschlägel ist auf „Brunnenvergifter-Tour“ (S. 493). Auch der Semesterbeginn im Oktober 1980 bringt ihn zur Verzweiflung, denn „der Anblick von 25 Sandsäcken, gegen die ich anreden musste, ohne die geringsten Zeichen einer Reaktion aus ihnen hervorzulocken, war wahrhaft deprimierend.“ (S. 452). In späteren Jahren wird ihm die Präsenz im akademischen Betrieb, aber auch die Herausgebertätigkeit zur Last, er möchte nur noch schreiben. Sein Nierenleiden, das ihn mehrmals in der Woche zu einem vierstündigen Dialysetermin zwingt, ist aber neben der Belastung und Lebenseinschränkung auch eine Chance: den permanenten Anfragen für Kongresse und Tagungen guten Gewissens Absagen erteilen zu können.
Mit der Krankheit tritt, gerade in den allerletzten Lebensjahren, ein Thema in den Vordergrund: Die Obsession des Schreibens und der Verdacht, nicht gelesen und nicht verstanden zu werden (S. 568). Der Aufforderung seiner Auftraggeber, etwa Reich-Ranickis, Rezensionen verständlicher zu verfassen, widersteht er; auch bei der Arbeit an den Beiträgen zum Funkkolleg Musik lehnt er Zugeständnisse, auf den pädagogisch-medialen Charakter des Unternehmens abzielend, ab unter Verweis auf die Notwendigkeit, in „menschenwürdiger“ Sprache schreiben zu müssen (S. 274). Mitte der 1980er Jahre nehmen die Selbstzweifel stark zu, sie gipfeln in der von Verzweiflung und Enttäuschung getragenen Furcht, „meinen Stil kaum noch [zu] ertragen“ (S. 612).
Die Herkulesaufgabe, aus dem gigantischen Quellenmaterial ein spannendes Lebensbild entstehen zu lassen, das neben Streiflichtern auf die Person Einblicke in die Werkstatt des Autors gestattet, darf – mit den Einschränkungen zur Textgestalt – als geglückt bezeichnet werden. Dank der durchgängig sprachlichen und stilistischen Brillanz kommen nicht nur Dahlhaus-Schüler und -kenner auf ihre Kosten – in den Briefen entfaltet sich ein Panorama des Geisteslebens des alten Westdeutschlands bis zur Wende.
Rüdiger Albrecht
Berlin, 02.12.2022
