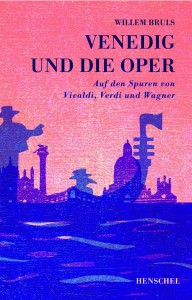 Willem Bruls: Venedig und die Oper. Auf den Spuren von Vivaldi, Verdi und Wagner / Aus d. Niederländ. übers. von Bärbel Jänicke – Leipzig: Henschel, 2021. – 263 S.: s/w-Abb.
Willem Bruls: Venedig und die Oper. Auf den Spuren von Vivaldi, Verdi und Wagner / Aus d. Niederländ. übers. von Bärbel Jänicke – Leipzig: Henschel, 2021. – 263 S.: s/w-Abb.
ISBN 978-3-89487-818-4 : € 20,00 (geb.)
Venetiaanse zangen heißt im niederländischen Original das in Amsterdam erschienene Venedig-Buch des literarisch, dramaturgisch und journalistisch rührigen Willem Bruls, Jahrgang 1963. In guter Absicht spezifiziert der Verlag Henschel den Titel von Bärbel Jänickes nobler Übersetzung durch einen Fokus auf das venezianische Paradegenre Oper, vertreten durch die Protagonisten Vivaldi, Verdi und Wagner. Dies weckt das Interesse an gewiss viel Bedeutendem, dechiffriert aber bei Weitem nicht alles, was Bruls aus dem kulturgeschichtlichen Kosmos der Lagunenstadt zutage gefördert hat – optisch in kleinem Buchformat, inhaltlich von umso bezwingenderer Informations- und Textdichte. Und wer sich gerade in den Mythos des musikalischen Venedig vertiefen möchte, wäre unter Umständen von den ursprünglich titelgebenden „Venezianischen Gesängen“ nicht weniger elektrisiert. Gleichwohl: „Venedig ist Oper.“ (S. 9) Davon kündet allein das Motto des Vorworts.
Da sich Bruls aber im Wortsinn physisch auf die Spuren begibt und keinen lexikalischen Werkführer annonciert, überträgt er den Terminus Oper metaphorisch auf die Stadt als Ganzes: Allein die Gotik-, Renaissance- und Barockfassaden oder Stuckinterieurs spiegeln architektonisch die musikalischen Fakturen der Großmeister von der spätmittelalterlichen Polyphonie bis zu Vivaldis Melodiegirlanden. Ein einzigartiges Ambiente mit Canal Grande, Markusplatz, Dogenpalast oder Palazzo Grimani formiert sich zur naturalistischen Opernkulisse. Und nicht zuletzt die historisch-politischen Ereignisse in der jahrhundertelangen Stadtrepublik mit ihren Patrizierfamilien bieten Opernstoffe en masse, markieren zugleich aber auch einen Genius loci, ein unverwechselbares Fluidum, das mit Libertinismus, Hedonismus, sexueller Freizügigkeit, allerhand Liebe, Leidenschaft, Dramatik und krimineller Energie eben nur dort und nicht anderswo in solcher Drastik gedeihen und den Humus für bahnbrechende Werke der Welt- und Opernliteratur liefern konnte. Zwar erhebt Bruls mit poetischer Kraft den Nimbus der Metropole zum Haupterzählzweck. Zugleich aber grundiert er ihn – musik- und kunstgeschichtlich auf gleichem Niveau – kenntnisreich und geballt deskriptiv mit Daten und Fakten. So bleibt der Leser im atmosphärischen Zauber gefangen, lernt überdies aber Details der Stadt, ihre kulturgeschichtlich eminenten Sehenswürdigkeiten und last not least die hier in Szene gesetzten Epochalwerke kennen.
In insgesamt zwanzig Impressionen nimmt Bruls uns mit auf Tour. Seine Route orientiert sich dabei grosso modo an der Werkchronologie der Musikgeschichte von Monteverdi bis Nono. Durchgehend aber befinden wir uns, besonders in den auch sozial- und kulturkritischen Kommentaren, mitten im Venedig des laufenden 21. Jahrhunderts. Zwar tendieren Nahaufnahmen zentraler Objekte und Werke zu exkursartigen Einzelanalysen. Ungemein spitzfindig erscheinen sie umso mehr verwebt in die rhapsodischen Erzählströme, die mal vom Schlaglicht auf bildnerische Ikonen, mal vom Sinneseindruck an baulichen Ensembles inspiriert sein können. Vor dem Sprung in die Zeit einer glorreichen Musikblüte Venedigs etwa führt der Weg in die geographische Urgeschichte der Stadtgründung, ausgelöst durch die Vertreibung der Bewohner Aquileias von der Adriaküste anno 452 Richtung Torcello und Lagune durch Hunnenkönig Attila, dem freilich später Giuseppe Verdi mit gleichnamiger Oper ein Denkmal setzte, zugleich im Risorgimento die Vision eines wiedervereinigten Italien beschwor und ebenso den Nerv der Venezianer des 19. Jahrhunderts traf. Schließlich rührte der finale Opernsieg von zweifelhaften Charakteren an eigene Traumata aus wechselhafter Geschichte. Einer Geschichte, die umgekehrt konstant durchsetzt war von einer Rivalität mit dem päpstlichen Rom, welchem Venedig, da nicht aus dem Römischen Reich hervorgegangen, nur mühsam Paroli bieten konnte. Immerhin rührte der Reliquienschatz im Wahrzeichen, dem Markusdom, vom legendären Raub der Evangelisten-Gebeine aus Alexandria im 8. Jahrhundert, als sich stabile Handelskontakte in den Orient entwickelt hatten. Statt nach westeuropäischen Verhältnissen mit dem Dauerclinch zwischen Staat und Kirche bzw. Kaiser und Papst hielt man es staatspolitisch eher nach Art des wirtschaftlichen und kulturellen Konkurrenten Konstantinopel: Wie der Kaiser Ostroms zugleich das religiöse Oberhaupt verkörperte, tat dies der Doge in seinem Palast an der Adria. Auch auf handfestere Art bereicherte man sich am Bosporus: So wimmelt der Markusdom von Kunstgütern, die das Kreuzritterheer als Dank für venezianische Hilfe bei der maritimen Überfahrt nach Jerusalem 1204 aus ganz Byzanz geraubt und nach Italien transportiert hatte.
Wann und wo nun spielte im wahrsten Sinne des Wortes die Musik in Venedigs Mauern, auf seinen Straßen und Plätzen? Die erste Hälfte beginnt um 1600 und reicht bis 1800. Claudio Monteverdi, frustriert vom höfischen Arbeitgeber Gonzaga in Mantua, bewirbt sich 1613 erfolgreich mit der Vespro della Beata Vergine als Maestro di cappella an San Marco. Dort war das Feld schon bestellt: Der Niederländer Adrian Willaert mit seiner Etablierung der Instrumentalmusik im 16. Jahrhundert und die Gabrielis hatten Venedig zur musikalischen Speerspitze Europas ausgebaut. Deren und seine eigene polyphone Prima pratica kombinierte Monteverdi mit der monodischen, von der individuellen Hauptstimme dominierten Seconda pratica. Dabei vollzog er den Übergang vom damals Alten zum Neuen, von der Renaissance zum Barock. Nicht nur das: Die Geburt der Oper als Gattung sui generis initiiert er im Stile concitato mit dem Drei-Personen-Madrigal Il combattimento di Tancredi e Clorinda. Schließlich wollten – so die Vorgeschichte – Venedigs Patrizier nicht zurückstehen gegenüber den theatralischen Oratorien Roms und den Operngenüssen der Aristokraten auf dem Festland. So kam es zur Uraufführung der Novität im Palazzo Mocenigo, dessen Auffinden und heutiges Erscheinungsbild Bruls wie manche anderen Lokalitäten, wenn sie denn noch existieren, als eher ernüchternd beschreibt.
Dies betrifft ähnlich die ansässigen Bühnen der Monteverdi-Zeit, von denen Bruls flanierend überwiegend Reste vorfindet, dabei umgekehrt aber institutionshistorisch viel Erhellendes sowie Essentielles zur musikalischen Dramaturgie von Il ritorno d’Ulisse in patria zu referieren weiß. Auf seiner Visite im Teatro Malibran erfährt Bruls, der über sich selbst als Person nur wenig Charakteristisches preisgibt, vom Repetitor persönlich, dass der Beginn der Opera buffa seiner These nach nicht in Neapel, sondern direkt vor Ort 1704 mit der Seria-Parodie La fortuna per dote von Carlo Francesco Pollarolo anzusetzen sei.
Zu Monteverdis L’incoronazione di Poppea und – in deren Schlepptau – Francesco Cavallis stilverwandter La Calisto sucht sich Bruls philologische Instruktion durch den Musikwissenschaftler David Bryant, der ihm mittels zweier Handschriften in der Biblioteca Marciana auch Desillusionierendes vor allem zu Monteverdis Autorschaft nicht erspart. Umso aufschlussreicher dann ein struktureller und kulturgeschichtlicher Vergleich der beiden erotisch aufgeladenen Ausstattungsstücke: In Venedig – pragmatischer gepolt als die idealistische Opernwiege Florenz um die Medici – „diente die Oper nicht nur als Propagandamittel für die herrschende Klasse, sondern auch als Mittel der Kritik an dieser Klasse. Es gab eine Tradition, die nicht nur die Tugenden besang, sondern auch darauf hinwies, wie Regeln gebrochen wurden. Das große Vorbild war die griechische Tragödie mit ihrer starken Spannung zwischen Individuum und Gesellschaft.“ (S. 85).
Dass der Patrizierdynastie der Grimani nicht nur durch politisches Schwergewicht und nahezu monopolhaften Theaterbesitz Impulse auf internationaler Opernbühne zu verdanken sind, beweist schlagend Kardinal Vincenzo Grimani durch sein Libretto zur Agrippina des jungen Georg Friedrich Händel, der hier die neapolitanische Arienvirtuosität mit subtiler Anwendung des begleiteten Rezitativs verband und eine Richtung wies, „die so nur in Venedig entstehen konnte.“ (S. 100). Dort fast lebenslang präsent war der im deutschen Untertitel des Buchs priorisierte Antonio Vivaldi. Wir erfahren von einem Vivaldi-Bashing seines Neiders, wenn auch als Sakralkomponisten denkwürdigen Benedetto Marcello, besuchen mit Bruls Vivaldis Wirkungsstätte Ospedale della Pietá und gleichartige Bildungsinstitute (Waisenhäuser als formidable Talentschmiede) und erhalten die Deutung des Meisterwerks Orlando furioso als Plädoyer für den tugend- und standhaften Renaissancemenschen per Interview mit dem renommierten Orchesterleiter Andrea Marcon.
Die Suche „nach dem ultimativen Symbol des venezianischen Libertinismus des 18. Jahrhunderts“ (S. 137) führt den Kulturtouristen ins Hotel Monaco e Grand Canal, beheimatet im Gebäude des ehemaligen Palazzo Dandolo. Dessen großer Rokoko-Saal kündet von einer früheren Topadresse unter den sogenannten Ridottos, in denen sich die Lebewelt vom Patrizier über den Reisenden bis zur Prostituierten bei Geselligkeiten aller Art, auch der sexuellen, die Klinke in die Hand gab. Als gern gesehenen, aber verkannten Gast reanimiert Bruls‘ Nostalgie den berühmten Giacomo Casanova. Im wirklichen Leben ein Liebesheld der humanen Gesinnung, der stets nur das einvernehmliche Abenteuer suchte, verteufelte ihn vor allem die Sippe Grimani als skrupellosen Verführer. Obwohl er laut Gerüchten denselben Grimanis unehelich entstammt sein könnte, setzten sie ihm ein denunziatorisches Denkmal mit einem von Giuseppe Gazzaniga vertonten Don Giovanni Tenorio. Des Librettos von Giovanni Bertati sollte sich im selben Jahr 1787 recht großzügig Lorenzo da Ponte für Mozarts fast gleichnamiges Paradewerk bedienen.
So weit, so herrlich. Allerdings nur, bis – so Bruls mit Pathos – „Ende des 18. Jahrhunderts mit den Napoleonischen Kriegen alles abrupt endete. Venedig hörte auf, als autonomer Stadtstaat und damit als erotisches Asyl und sinnliche Freistatt zu existieren. Was in den folgenden zwei Jahrhunderten geschah, ließe sich vielleicht am besten als ein langsames Dahinsiechen beschreiben – ohne jemals den Tod finden zu können.“ (S. 10). Durch Verlagerung des Welthandels an die Atlantikküste kam schon seit dem 16. Jahrhundert der ökonomische Abstieg. Dennoch blieb Venedig zumindest durch das 18. Jahrhundert hindurch ein florierendes Zentrum der Künste aller Disziplinen. Und trotz Verarmung des Patriziats „erblühte eine dekadente Schönheit, die Besucher wie ein Magnet anzog.“ (S.151-152) Im Ton erhabener Metaphorik fasst Bruls zusammen: „Doch die flirrende Mischung aus Ästhetizismus und Libertinismus, aus künstlerischer und körperlicher Lust fand ein jähes Ende. Nach 1797 blieb davon nur noch eine bittersüße Erinnerung. Der morbide Leichnam dieser Erinnerung wird nun schon mehr als zwei Jahrhunderte einbalsamiert bewahrt.“ (S. 152)
Künstlerische Großereignisse blieben jedoch auch und gerade vor dieser Kulisse nicht aus. Bruls durchleuchtet auch sie mit beseelter Erzählkraft, reichem Detail- und Literatenschatz, Belesenheit und pointiertem Blick in die mentalitätsgeschichtliche Gemengelage: voran Gioachino Rossinis Erfolge, Lord Byrons ansteckenden romantischen Venedig-Kult, Verdis gewagtes Gesellschaftsbild La traviata und seine Uraufführungsstätte La Fenice (hier auch Kritisches zu Architektur und Kulturpolitik), Richard Wagner „im Café“ bzw. Tristan und Isolde und Parsifal mit ihrer Entstehung um und während Wagners Aufenthaltszeit am späteren Sterbeort, sein Gesamtkunstwerk im Vergleich mit den Visionen seines Adepten Gabriele D’Annunzio, Schlusslichter: Thomas Manns Der Tod in Venedig und seine Adaptionen von Luchino Visconti und Benjamin Britten, schließlich Luigi Nono mit Prometeo als bewusstseinserneuernder und das hörende Individuum in die Pflicht nehmender Tragedia dell‘ascolto, 1984 präsentiert in der Kirche San Lorenzo. Nach einem Besuch der Gräber Nonos, Igor Strawinskys, Sergei Djagilews und anderen auf dem Cimetero San Michele kommt „im Venedig des Hier und Jetzt“ (S. 248) Kulturpessimismus auf: „Was bleibt in diesem Pandämonium der Vermarktung von Geschichte noch vom Musikleben, den Komponisten, der Oper und den Menschen, die dem allen herzlich zugetan sind? Gibt es nach Nonos ultimativer musikalischer Fragmentierung noch eine Zukunft?“ (S. 249) Eine Chance hat zumindest der Ausblick auf ein Panta rhei, ein immerwährendes Fließen: „Die alten Mythen und die Kraft der Tradition dringen in Venedig immer wieder dicht an die Oberfläche der heutigen Zeit (…), um alle daran zu erinnern, dass diese Vergangenheit unausweichlich ist und die Zukunft bestimmen wird.“ (S. 250)
In Bruls‘ persönlicher Wertung bietet „Literatur zum Weiterlesen“ und „Musik zum Weiterhören“ wertvolle Anregung. Quellenauswahl und Personenregister kompensieren den (angenehmen) Verzicht auf Fußnoten und nummerierte Anmerkungen. Was sie nicht kompensieren (sollen und wollen): Fernweh nach einem Sehnsuchtsort!
Andreas Vollberg
Köln, 25.05.2021
