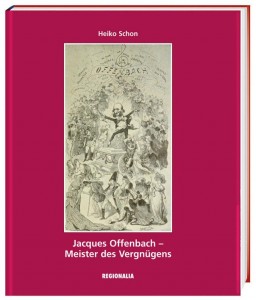 Heiko Schon: Jacques Offenbach – Meister des Vergnügens. – Daun: Regionalia, 2018. – 216 S.: Farb- u. s/w-Abb.
Heiko Schon: Jacques Offenbach – Meister des Vergnügens. – Daun: Regionalia, 2018. – 216 S.: Farb- u. s/w-Abb.
ISBN 978-3-95540-332-4 : € 14,95 (geb.)
Mit Fug und Recht frohlockt die Kölner Offenbach-Gesellschaft zum runden Geburtstag ihres Namenspatrons Jacques (1819-1880). Denn nicht nur Konzertveranstalter, Bühnen und öffentliche Diskutanten konnte sie rund um den Hohen Dom zur ganzjährigen Hommage Yes, we cancan am Rhein versammeln. Auch die Musikschriftstellerei erhielt, schon im Vorjahr, einen einschlägigen Auftrag. Gewünscht war ein Beitrag mit kölntypischer Note: wissenschaftliche Faktentreue in humoriger Verpackung. Den Zuschlag erhielt mit glücklicher Hand Heiko Schon, Jahrgang 1978, der nach Erfahrungen in Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für das Land Berlin sowie im Vertrieb der dortigen Deutschen Oper als freier Autor originelle Themen wie das Handwerk auf der Opernbühne beackert und einen queeren Opernführer vorbereitet.
Dass Schon es auch im bordeauxroten Offenbach-Band hin und wieder queer zugehen lässt, wäre wohl nicht nur dem gefeierten Meister des Vergnügens eine Freude gewesen. Gerade der Offenbach-Interessent des 21. Jahrhunderts sucht nach aktueller Auslegung, weiß um das auch heute noch brisante Potential in Person und Werk Offenbachs, mag es satirisch, burlesk oder auch dramatisch bis lyrisch-melancholisch daherkommen. Wie am Offenbachschen Paradegenre der Travestie frappiert auch an Schons flotter Schreibe, wie die überzeitliche Substanz des Oeuvres Kontur gewinnt durch die publizistische Brille von heute. Diese verbindet intensiv recherchierte Informationsfülle mit perspektivenreicher Präsentationsform. Einleitend suggeriert die Inhaltsübersicht einen Aufsatzband mit 16 Offenbachiana, deren metaphorisch aufgepeppte Überschriften anfangs eher biographische, fortlaufend dann ästhetische und werkbezogene Schlaglichter ankündigen.
Der Einstieg mit „Jacques Offenbach und die Entdeckung des Cellos“ ermöglicht eine schlüssige Zusammenschau der persönlichen und künstlerischen Anfänge des Virtuosen in Köln, schlägt zugleich den Bogen zur Rolle des Instruments im Gesamtschaffen. Nach gleichem Prinzip verfährt Schon auch behufs Klärung „Jacques Offenbach, en Kölsche Jeck?“ Denn wie er im Cello-Kapitel anekdotisch verriet, Jacques beherrsche am Cellopult der Pariser Opéra-Comique schnell die später für ihn einflussreichen „Partituren aus dem Effeff“ (S. 11), ist Jakob beim ersten Kölner Karnevalszug 1823 für ihn ein „dreijähriger Knirps“ (S. 22), dessen spätere Karnevalserlebnisse wie das sprichwörtliche Kölner Divertissementchen er sorgfältig differenzierend auf mögliche Spuren etwa in Spitzenwerken wie Orphée aux Enfers überprüft.
Obgleich salopp als „singende, klingende Synagoge“ überschrieben, würdigt ein scharfer Blick auf Offenbachs jüdische Provenienz zunächst die Prägungen im Umfeld von Vater Isaac als Kantor in Köln und blickt aus bis Jakobs Übertritt zum Katholizismus (cherchez la femme), der ihm die Heirat mit Herminie d’Alcain ermöglichte. Kennengelernt hatte er sie in der Welt der Pariser Salons, deren Kultur im Folgekapitel historisch und in ihrem Sprungbretteffekt für das auch bravourös komponierende Cellowunder lebendig wird. „Spuren am Rhein“ resultieren aus familiären Heimatbesuchen, applaudierten Werkpräsentationen, pikanterweise auch aus patriotischen Gesängen, die der Wahlfranzose angepasst den 1848 revolutionär begeisterten Mannen von Bürgerwehr und Kölner Gesangvereinen in die Kehlen schrieb. Hinter Offenbachs „großen Freuden und kleinen Sünden“ gelingt ein Kabinettstück der Charakterzeichnung, das den bescheiden formulierten Anspruch „Jacques‘ Persönlichkeit ein klein wenig einzufangen“ (S. 67) ebenso freundlich (aufopfernde Eltern und Gattin, emotionale und soziale Intelligenz) wie ungeschminkt (Exzentrik, Schulden, Affären) einlöst.
Zum Kern des Oeuvres führen über erste Kölner Impressionen mit Stadtsoldaten und Roten Funken zur Preußenzeit die „rasselnden Säbel“. Nach der Flucht in die Heimat während der 48-er-Unruhen trifft Offenbach, zurück an der Seine, auf das Zweite Kaiserreich Napoleons III. Dessen prachtverliebte Herrschaftsinszenierung, begleitet von einer brummenden Wirtschaft und einem Bürgertum im Geldrausch, liefern den Humus für Offenbachs neu kreiertes Satiregenre an seinem 1855 eröffneten Théâtre des Bouffes-Parisiens. Erfreut sich der Herrscher selbst an seiner Karikatur als Jupiter im Orphée, so trumpfen Offenbach und seine Librettisten Henri Meilhac und Ludovic Halévy nach kaiserlichem Autoritätsverlust 1867 exemplarisch auf mit La Grande-Duchesse de Gerolstein und „quetschen viel spöttische Schmiere in die Kriegsmaschinerie“ (S. 82). Nicht verschwiegen wird, wie Offenbach im Zuge des Deutsch-Französischen Kriegs zwischen die Fronten gerät: Frankreich verargt ihm seine einstigen deutschen Kampflieder, Deutsche stigmatisieren ihn als Vaterlandsverräter. In der Dritten Republik verlegt Offenbach den Akzent vom Politischen aufs Phantastische und regeneriert mit viel Theaterdonner und Budenzauber die ältere Opéra-féerie.
Ihr und der Travestie in Offenbacher Spezifik spürt Schon in separaten Betrachtungen nach. Amouröses und Genießerisches kommen keinesfalls zu kurz: Frauen, Gaumenfreuden und Hochprozentiges werden in ihrem Vorkommen zwischen Vita und Bühnenwerk abgeglichen. Unter Offenbachs „Leben aus dem Koffer“ folgt der Leser dem innereuropäisch permanent Umtriebigen gerne auch auf Amerika-Tournee. Mit Offenbach und dem „Wahnsinn der Beine“ geht es aufs Tanzparkett: Walzer symbolisieren den Rausch des Zweiten Kaiserreichs, von ostwärts schwappt die Polka herüber, und die ach so urtypischen Cancans hat Offenbach nie geschrieben. Kaum zu glauben. Aber es waren Galopps. Denn, so Schon: „Die schlüpfrige Touristenbespaßung, der sog. French-Cancan, entsteht erst 20 Jahre nach Offenbachs Tod.“ (S. 153). Gattungsgeschichtlich gewinnend lichtet sich der „Wirrwarr der komischen Genres“ von den Vorstufen über Offenbachs Kreationen auf den Feldern der Opéra-bouffe oder Opéra-comique bis zur Initialzündung der Operette. Das „offene Ende“ der Offenbach-Story schließlich manifestiert sich nicht allein in der Zeitgebundenheit von Aufführungstraditionen. Ein Fass ohne Boden bleiben hier zumal Offenbachs nachgelassene Les Contes d’Hoffmann, deren Herausforderung im Fehlen einer Endfassung wie auch in ihrem schillernden Resümeecharakter für das Offenbachsche Idiom besteht: „Frauen, Bühnenzauber, Alkohol, Travestie, Parodie, schwarzhumorige Ironie – alles dabei.“ (S.188-189)
Als füge sich die essayistische Palette nicht von selbst bereits zu einem unterhaltsamen Offenbach-Porträt, offenbart sie nach Ende des ersten Kapitels eine zweite Dimension: einen fast Beikircherschen Werkführer mit nicht weniger als 101 Artikeln zu Offenbachs Bühnenwerken, die ja nicht nur Buffonerien, sondern neben den berühmten Contes d’Hoffmann erratische Sonderlinge wie die romantischen Rheinnixen oder die Schauspielmusik zu Victorien Sardous blutrünstigem La Haine umfassen. Thematisch passend folgt etwa ein halbes Dutzend pro Sachbeitrag. Nach gleichem Muster heißt es darin „Worum geht’s?“, „Was steckt dahinter?“ (kurze, aber wichtige Essentials), „Die stärkste Nummer ist…“ und „Zum Reinhören“ (diskographische Hinweise). Der Rezensent dankt, gratuliert und wünscht viel Vergnügen bei der Lektüre – nicht nur im Offenbach-Jahr!
Andreas Vollberg
Köln, 24.02.2019
