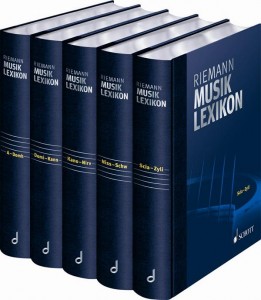 Riemann Musik Lexikon. Aktualisierte Neuauflage in fünf Bänden / Hrsg. von Wolfgang Ruf in Verbindung mit Annette van Dyck-Hemming. – Mainz: Schott, 2012. – 511, 512, 512, 510, 494 S.: Abb., Notenbeisp.
Riemann Musik Lexikon. Aktualisierte Neuauflage in fünf Bänden / Hrsg. von Wolfgang Ruf in Verbindung mit Annette van Dyck-Hemming. – Mainz: Schott, 2012. – 511, 512, 512, 510, 494 S.: Abb., Notenbeisp.
ISBN 978-3-7957-0006-5 : € 169,00 (geb.)
Die Tradition des Riemann Musik Lexikons ist eine durchaus ehrwürdige, aber nicht ganz unproblematische. Stand die von Hugo Riemann selbst verfasste erste Auflage im Jahr 1882 noch unter der Kritik, einen „von augenblicklichen Strömungen zu sehr beeinflussten“ Standpunkt erkennen zu lassen (siehe G. Jacobsthals Rezension in der DLZ 3, 1882, Nr. 25, Sp. 903f.), so hat noch Riemann selber in den von ihm betreuten weiteren Auflagen bis 1919 diesem Missstand eines gewissen Unverständnisses früheren Perioden der Musikgeschichte gegenüber abzuhelfen versucht. Auch in den später von Alfred Einstein, Wilibald Gurlitt, Hans Heinrich Eggebrecht und Carl Dahlhaus verantworteten und teilweise völlig neu bearbeiteten Auflagen, deren immenseste Ausdehnung in der zwölften aus den Jahren 1959–1975 erreicht wurde (und prompt in den Jahren 1978–1995 in einer komprimierten aber gleichwohl aktualisierten und ergänzten Version auf den Markt gebracht werden musste), konnte von diesem Missstand keine Rede mehr sein. Trotzdem ärgerten bis in diese letzte Version hinein mitgeschleppte, einer fragwürdigen Traditionsbildung geschuldete Klischees, die man hoffte – neben den erhaltenswerten Qualitäten dieses Lexikons – in einer Neuauflage endlich beseitigt zu finden. Dadurch hätte man ein bisschen dazu beitragen können, den unhinterfragten Sumpf bestimmter unbegründeter Behauptungen, von denen Musikjournalisten und Rundfunkmoderatoren bei flüchtigem Nachschlagen für ihre schmusigen Moderationen weiter unverdrossen bequem profitieren können, endlich trocken zu legen. In dieser Hinsicht ist die jetzt von einem Redaktionsteam aus Halle/Saale unter der Leitung von Prof. em. Wolfgang Ruf (der nicht zufällig aus der terminologischen Schule Eggebrechts kommt) vorgelegte Neuauflage nach einer Menge von Vergleichen und Stichproben als mitunter enttäuschend zu bezeichnen.
Verglichen werden kann diese Bearbeitung aber nicht wirklich mit der 12. Auflage, denn sie nennt sich zwar mutig die 13. Auflage, ist aber tatsächlich nur eine Aktualisierung der komprimierten Sonderausgabe, die Schott zusammen mit Brockhaus bis 1995 publiziert hatte, und vereinigt wie diese Personen- und Sachartikel in einem Alphabet. Sie dennoch als 13. Auflage auf den Markt zu bringen, könnte positiv nur bedeuten, dass man das Riemann Musik Lexikon wieder in das Format der alten Auflagen vor der aufgeblähten und unhandlich gewordenen 12. zurückführen will, wogegen prinzipiell nichts einzuwenden wäre, obwohl dadurch – besonders im Bereich der erwähnten und beschriebenen Personen – mancher Verlust zu beklagen ist. Schon Einstein hatte in der 11. Auflage von 1929 “Lebensdaten uns völlig entfremdeter Musiker aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts” ausgemerzt. Ja, weg damit, könnte man sagen, aber: nach welchen Maßstäben wird entschieden, ob ein Musiker noch aktuell oder „uns entfremdet“ ist. Und warum soll an Fremdartiges, sogar heute abwegig Erscheinendes nicht mehr erinnert werden? Einstein musste nach 1933 merken, wie schnell er selber zu einer solchen „uns völlig entfremdeten“ Person deklariert wurde. Und: ist mancher Musiker uns vielleicht entfremdet nur, weil wir „augenblicklichen Strömungen“ nachjagen, von denen schon die nächste Generation sagen wird, diese seien ihr entfremdet? Um ein Beispiel zu geben: Sicher ist ein Prager und Wiener Musiker wie Viktor Lederer (1881–1944) mit seinen Thesen über den Einfluss der keltischen Musikkultur auf das ausgehende Mittelalter „uns völlig entfremdet“, sein Schicksal jedoch könnte dazu anhalten, an seiner Nennung festzuhalten, um das Gedächtnis an ihn wachzuhalten. Was Gurlitt 1961 in der 12. Aufl. (Personenteil L–Z, S. 43) noch nicht wissen konnte oder wollte (er ließ das Todesdatum offen), wusste dann 1975 Dahlhaus im Personen-Ergänzungsband L–Z bis in die Diktion hinein korrekt nachzutragen: „† nach dem 12.10.1944 (Datum der Deportation aus dem Getto Theresienstadt in das Vernichtungslager Auschwitz)“ (S. 30). Noch im komprimierten Brockhaus-Riemann von 1989/1995 steht diese Angabe, in der 13. Auflage gibt es keinen Viktor Lederer mehr.
Auch Stichproben kann der Rezensent nur da stichhaltig machen, wo er sich auszukennen meint. Gehen wir in die Sachartikel: Die regional vielfältige und in sich widersprüchliche Gebrauch des Alla-Breve-Taktes wird im Gegensatz zur 12. in der 13. Auflage weder durch den Artikel Alla Breve, noch durch den stark gekürzten Artikel Tactus klar, im Gegensatz zu den Artikeln Kammer- resp. Stimmton, der die früher existierende Bandbreite deutlich macht, ohne allerdings (wie üblich) die Frage zu ventilieren, was beispielsweise der Charakteristik der Tonart Es-Dur widerfährt, wenn man ein in ihr geschriebenes Stück andernorts oder im Laufe der Zeit um einen Halbton höher geschraubt in E-Dur erklingen lässt. Darf man solche Fragen in einem Lexikon nicht stellen?
Einer Aktualisierung bedurft hätten u.a. die Artikel über die rhythmischen Modi des Mittelalters und die so genannte Modalnotation; hier wurde gegenüber der 12. Auflage außer der bereits vorhandenen Komprimierung der Texte und einer Aktualisierung der Literaturangaben nichts geleistet, obwohl neuere Forschung hätte dazu führen können mitzuteilen, dass „in Anlehnung an die modalen Rhythmen heute (sic! eben nicht mehr) auch nicht modal notierte Stücke außerhalb des Notre-Dame-Kreises (→ Trobadors, → St. Martial) rhythmisch gedeutet“ werden, wie es wohl 1967, zu Zeiten der Drucklegung des Sachteils der 12. Aufl. im Gefolge der herrschenden „Modaltheorie“ noch der Fall war. Im Artikel Trobadors wird man da schon vorsichtiger, wie überhaupt manche nötige Querverbindungen zwischen den Artikeln nicht hergestellt wurden. Abgesehen davon sucht man an dieser Stelle auch in der 13. Aufl. vergeblich auch nur einen Verweis auf die modale Harmonik des Mittelalters (im Gegensatz zur Dur-Moll-tonalen der Neuzeit) und die entsprechenden Modi (Tongeschlechter), die ausschließlich unter dem Stichwort Kirchentöne verhandelt werden.
Aus den Personenartikeln sei jener über Wolfgang A. Mozart herausgegriffen. Erstaunlich, mit welchem Beharrungsvermögen bestimmte Vorurteile und eingeschliffene Bewertungen, besonders über den jungen Mozart, hier wieder und immer noch auftauchen. In der Charakterisierung der frühen Sonaten für Clavecin und begleitender Violine des Achtjährigen wird der Violinpart weiterhin als ad libitum bezeichnet, obwohl neuere Untersuchungen das bezweifeln konnten, in seinen ersten Opere serie (hier sind wahrscheinlich die Mailänder Opern ab Mitridate gemeint) habe Mozart „die konventionelle Librettoform einfach hingenommen“ (Bd. 3, S. 418), erst im Idomeneo wäre ihm das Verhältnis von Musik und Drama zum Problem geworden (ebd.), obwohl neuere Untersuchungen für die Zeit vor Mitridate den genau gegenteiligen Befund erbrachten. Eine ähnliche Missachtung erfahren nicht zufällig die Jungendopern Mendelssohns. In den „gewichtigen kirchenmus. Werken der Wiener Periode“ Mozarts (gemeint ist wohl die c-Moll-Messe) sei „der gewaltige Eindruck von Bach und Händel deutlich zu spüren“ (S. 419), obwohl bisher nicht nachgewiesen werden konnte, dass Mozart (außer Bachs Wohltemperiertem Clavier) auch nur eine einzige vokal-instrumentale Großkomposition Bachs gekannt haben könnte. In diese Kategorie gehört natürlich auch der aus der 12. Aufl. hinüber gerettete „bachisierende Kontrapunkt“ in der Zauberflöte, zu dem es eigentlich keinen Anhaltspunkt gibt, denn Mozart war natürlich von Kindesbeinen an in Ostinato und italienischer Fugenkomposition geübt.
Um nicht in weiteren notgedrungen subjektiven, an den Interessen einzelner Leser, Benutzer oder Forscher ausgerichteten Überprüfungen hängen zu bleiben, sei gesagt, dass sicherlich der Löwenanteil der Artikel, deren Substanz auf mehrere Forschergenerationen seit Riemann zurückgehen, viele sachlich stimmige Informationen bietet oder anbietet, die vorbehaltlos bis kritisch verwandt werden können oder mit denen sich auseinanderzusetzen für selbständige Köpfe lohnend ist. Denn es ist auch für ein mehrköpfiges Kollegium von Lexikografen schier unmöglich, in allen Fragen auf der Höhe der Zeit, sprich dem Stand der Forschung zu sein, oder sollten sie es doch? Die Mehrzahl der Nutzer solcher Lexika begibt sich aber meist, anderer Wissensquellen ermangelnd (obwohl das Internet inzwischen viel und in manchen Fragen mehr zu bieten hat), in eine freiwillige Abhängigkeit von solchen Nachschlagewerken. So ist es immerhin sehr erfreulich, dass dieser alt/neue Riemann sich vor allem in den Personenartikeln von einer euphorischen bis euphemistischen oder apologetischen Redeweise, wie sie lange üblich war, getrennt hat, und die „Meister“, „Magier“ und „faszinierenden“, „kühnen“, „bahnbrechenden“ „hochbedeutenden“ Persönlichkeiten nun Künstlern und Wissenschaftlern Platz gemacht haben, die bestimmte Lebensdaten hatten und bestimmte Werke schufen, mit deren wertender Einordnung man vorsichtig umgehen sollte, d.h. zu der stets mehr als immer nur eine Möglichkeit besteht.
Es enthalten diese fünf Bände an vielen Stellen auch erfreuliche Revisionen und Richtigstellungen, die entsprechend genutzt werden sollten. Auch die Fachgeschichte der Musikwissenschaft (deren oben zitierter erster Ordinarius in diesem Zusammenhang nicht genannt wird) ist im allgemeinen wie in den besonderen Gliederungen ihrer Abteilungen, Disziplinen, speziellen Forschungsgebieten und augenblicklichen Strömungen ausführlich beschrieben, womit aber zum Teil nur ihre heillose Zersplitterung widergespiegelt wird. Täter und Opfer aus den Reihen der Zunft während der nationalsozialistischen Ära werden kaum in den Personenartikeln bezeichnet, sondern eher summarisch in der Fachgeschichte aufgelistet. Willkürlich war und ist im Riemann Lexikon die Auszeichnung der Artikel mit oder (überwiegend) ohne Autorenkürzel; es ist kein Prinzip erkennbar und es wird auch keines genannt.
Summarisch gesprochen: Nützlich und schön, dass es „den Riemann“ wieder gibt, wenn auch nur in einer komprimierten und nur in leidlich aktualisierter Form.
Peter Sühring
Berlin, 02.11.2012
