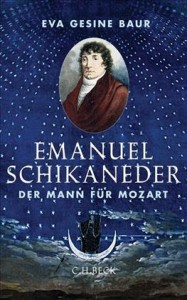 Baur, Eva Gesine: Emanuel Schikaneder. Der Mann für Mozart – München: C. H. Beck, 2012. – 464 S.: Abb.
Baur, Eva Gesine: Emanuel Schikaneder. Der Mann für Mozart – München: C. H. Beck, 2012. – 464 S.: Abb.
ISBN 978-3-406-63086-6 : € 22,95 (geb.)
Emanuel Schikaneder (1751–1812) war der richtige Mann für viele begabte Stückeschreiber, Schauspieler und Musiker. Eine literarisch wertvolle Biografie dieses heute fast nur noch als Librettist Mozarts bekannten Schauspielers, Sängers und Theaterdirektors liegt hier vor, mit der die Autorin ihm ein längst fälliges Denkmal setzen will. Sie erzielt das auch durch viele literarisch gut erzählte und gesetzte Pointen und literarische Ausschmückungen. Aber dennoch: Ihr Buch ist zugleich nur eine literarische Biografie in dem Sinne, dass es die Autorin mit dem Unterschied zwischen Dichtung und Wahrheit, Erfundenem, Hinzugedachtem und Tatsächlichem manchmal nicht so genau nimmt. Manchmal wird, was nicht zusammen passen will und kann, passend gemacht. Baur erzählt mit dem literarischen Trick des grammatikalischen Tempus Präsens, mit dem sie, erfrischend zu lesen, alles in eine fiktive Gegenwart rückt. Das erweckt den Eindruck, als wäre sie selbst dabei gewesen und kenne sich in den Beweggründen für manche Handlung, manchen Sieg und manche Niederlage und im Gefühlsleben ihres Haupt- und mancher ihrer Nebenprotagonisten bestens aus. Schon der Untertitel fokussiert Schikaneder wieder – der weit verbreiteten Unkenntnis über diesen Theatermann Rechnung tragend – auf seine kurzfristige, für beide sehr wichtige Beziehung zu Mozart während der gemeinsamen Produktion der Zauberflöte in dem von Schikaneder geleiteten Wiener Freihaustheater auf der Wieden. Auch das Bild auf dem Schutzumschlag mit Schinkels Sternenhimmel und der auf der Mondessichel stehenden Königin der Nacht suggeriert diese allzu bekannte Geschichte.
Und so mag es angehen, sich auch als musikalischer Rezensent auf das Schicksalsjahr 1791 und Schikaneders Beziehung zu Mozart, für den neben Daponte Schikaneder der richtige Librettist war, zu konzentrieren, um die Stärken und Schwächen von Baurs Methode zu zeigen. Bei ihr steht alles Diesbezügliche im XIII. Kapitel und heißt: Wien 1791. Wie sehr diese Oper steigt, was man als ein Mozart-Zitat vielleicht hätte in Anführungsstriche setzen sollen (S. 193–226, Anmerkungen S. 413–422). Baur ist um Aufklärung und Richtigstellungen bemüht und opfert deswegen drei ganze Seiten ihrer kleingedruckten Anmerkungen, um in acht ausführlichen Punkten Helmut Perls These zu widerlegen, die Zauberflöte sei auch zur Verteidigung des Illuminatenordens geschrieben worden. Baur hält diese Oper für einen Angriff auf denselben und kann diese Interpretation etwas plausibler machen als Perl die seine.
Um bei diesen Anmerkungen (die in der Form von nachgestellten Endnoten im hinteren Teil des Buches, aber – äußerst ungewöhnlich und gewöhnungsbedürftig – lediglich kapitelweise ohne Stellenbezug, also auch unnummeriert durchformuliert erscheinen) zu bleiben: Baur behauptet, die Perl-Kritik einleitend: „Direkte Vorlage für Mozarts Gesang der Geharnischten war der Choralsatz Gute Nacht, o Wesen aus der Motette Jesu, meine Freude von Johann Sebastian Bach.“ (S. 419) Während Perl immerhin bis auf ein „Lied der Protestanten“ zurückgeht, redet Baur auch im Haupttext öfter von jenem „Bach-Choral“. Diesen konnte Mozart aber schon gar nicht direkt aus Bachs Motette übernehmen, weil nicht überliefert und es auch äußerst unwahrscheinlich ist, dass er diese gekannt haben sollte. Im Publikum der Premiere habe Baron van Swieten gesessen, dem Mozart die „Annäherung an Bach“ (S. 221) zu verdanken gehabt habe. Hier bedient Baur ein altes, von einer übereifrigen Einflussforschung lanciertes Vorurteil, das aller historischen Grundlage entbehrt. Es ist so eingefleischt, dass es selbst bei dem als zuverlässig und streng geltenden Lektorat des Beck-Verlags als nicht zu beanstanden durchgegangen ist. Mozart hatte bei van Swieten lediglich eine Bekanntschaft mit Bachschen Tastenfugen gemacht und diese hatten ihn einerseits zu einem von ihm selbst für missraten gehaltenen Kompositionsversuch animiert, eine ebensolche Klavierfuge zu schreiben (von denen eigentlich nur seine Frau Constanze ganz schwärmerisch besessen war), andererseits dazu, sich mit ihnen kritisch auseinanderzusetzen, indem er sie für Streichquartett bearbeitete. Denn Mozart kannte und pflegte von Kindesbeinen an nur die auf mehrere Stimmen verteilte Vokal- und Instrumentalfuge und griff im Falle des Gesangs der Geharnischten nicht auf einen „Bach-Choral“, sondern auf den allseits bekannten protestantischen Choral von Johann Crüger Ach Gott vom Himmel zurück, den Bach selbst wiederum in seiner Motette nur als cantus firmus für deren 5. Strophe verwandt hatte.
Dann die Geschichte mit den „langen Ohren“! Mozart war laut einer berühmten Briefstelle stolz darauf, so zu komponieren, dass die Leute mit den spitzen Ohren (heute würde man sagen: die Kenner) sowie die mit den langen (heute würde man sagen: die Liebhaber, für die das Populäre gut genug ist) gleichermaßen Befriedigung erlangen. Wie Baur daraus machen kann, Mozart habe nie, außer eben in Verbindung mit Schikaneders Zauberflöte für lange Ohren schreiben wollen, ist völlig unakzeptabel. Außerdem gibt sie selbst genug Beispiele dafür, dass in der Zauberflöte (angefangen von der Fuge in der Ouvertüre) raffinierte Musik für spitze Ohren zu finden ist.
Schließlich die Seelenlage Mozarts im Frühjahr 1791, als die Zusammenarbeit mit Schikaneder begann. Baur weiß da viele intime Dinge zu berichten. Es geht, ausgehend von dem Namen des Monostatos (eines Alleinstehenden) und dessen von Mozart bevorzugte scherzhafte Umschreibung in Manostatos (also in einen auf seine Hand Gestellten) darum, wie ausgemergelt, nervös und sexhungrig Mozart zu dieser Zeit gewesen sein soll. Nichts gegen eine solche Spekulation, wäre sie als solche vorgetragen worden. Aber Baur meint, um dies zu belegen, sich eines Briefes Mozarts bedienen zu müssen, den dieser erst später an Constanze geschrieben haben kann, als diese, wenige Wochen vor der Uraufführung der Zauberflöte in Schikanders Freihaustheater sowie vor der Geburt des fünften Kindes in Baden zu Kur weilte.
Bleibt zu hoffen, dass sich Baur nicht auch auf den anderen, nicht mit Musik und Mozart zusammenhängenden Gebieten dieser Biografie ähnlicher Methoden der Anpassung der Wirklichkeit an ihre Vermutungen und selbstgebastelten Schlussfolgerungen bedient.
Peter Sühring
Berlin, 19.05.2012
