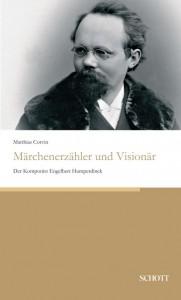 Matthias Corvin: Märchenerzähler und Visionär. Der Komponist Engelbert Humperdinck – Mainz: Schott, 2021. – 292 S.: Abb.
Matthias Corvin: Märchenerzähler und Visionär. Der Komponist Engelbert Humperdinck – Mainz: Schott, 2021. – 292 S.: Abb.
ISBN 978-3-95983-619-7 : € 22,99 (Pb., auch als Hc.)
Der nahende 100. Todestag Engelbert Humperdincks am 27. September 2021 könnte und sollte ein Anlass sein, sich mit seiner Musik wieder intensiver zu beschäftigen. Nach einem gesteigerten Interesse an deutschen Opern- und Konzerthäusern an Aufführungen sieht es nicht gerade aus. Immerhin kann ein Anfang des Jahres erschienenes, in das gesamte Werk Humperdincks einführendes Buch ein erst noch zu weckendes Informationsbedürfnis gut befriedigen. Wie Humperdincks Zeitgenosse Max Bruch mit seinem Violinkonzert in g-Moll (dem man meist noch vergisst, die Serien-Nr. 1 beizufügen) so ist auch Humperdinck selbst sehr zu Unrecht einer von jenen „Ein-Werk-Komponisten“ geworden, weil die Nachwelt sich weitgehend damit begnügt, ihn fast nur als den Komponisten der Märchenoper Hänsel und Gretel wahrzunehmen, die er angeblich für Kinder geschrieben haben soll (und nicht als ein musikdramatisches Lehrstück für Eltern und andere böse Deutschen) und die meist nur in vorweihnachtlichen Familienaufführungen sonntagnachmittags gegeben wird. Welch ein Irrtum! Sind doch Humperdincks weitere Märchenopern Königskinder und Dornröschen, seine zahlreichen Schauspielmusiken, v. a. zu Shakespeare-Stücken, Orchesterstücke (darunter so imposante wie eine Maurische Rhapsodie), Kammermusik (darunter das frühe Klavierquintett und ein spätes Streichquartett) und seine unzähligen Lieder nicht weniger bedeutend. Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein änderte sich seine stilistische Fixierung auf eine romantisch erweiterte Harmonik allerdings kaum, sodass seine späteren Werke trotz ihrer Schönheit gerne als anachronistisch und rückwärtsgewandt belächelt werden – ein Schicksal, das Humperdinck mit Bruch und dem Franzosen Saint-Saëns teilt.
Was das Genre der Märchenoper betrifft, so war seine Blütezeit eine kurze und fragile, wie überhaupt das Märchenerzählen auszusterben beginnt, obwohl ‑ wie Walter Benjamin noch in der 1930er Jahren wusste ‑, „das Märchen noch heute der erste Ratgeber der Kinder ist [war, muss man wohl heute sagen], weil es einst der erste der Menschheit gewesen ist. (…) Wo guter Rat teuer war, wußte das Märchen ihn, und wo die Not am höchsten war, da war seine Hilfe am nächsten“. Wenige Komponisten hatten mit dem Märchengeist eine so tiefe Geistesverwandtschaft wie Humperdinck. Aber das Genre konnte sich nicht etablieren, und schon nicht alle Märchenoper Humperdincks oder dann die eines bei ihm in die Schule gegangenen Leo Blech konnten bleibende Erfolge werden.
Auf 184, reich bebilderten Seiten erzählt Corvin Lebensumstände, Ansichten und Entstehungsgeschichten der komponierten Werke Humperdincks so, dass ein lebendiges Bild dieses oft gelobten und oft verkannten Musikers mit menschlichen Visionen entsteht. Was Hänsel und Gretel betrifft, so werden hier erstmals die genaueren Bearbeitungsstufen vom Liederspiel zum Singspiel bis zur ausgereiften exemplarischen Märchenoper aufgezeigt, ebenso wie die bei Königskinder die vom Melodram zum Märchenspiel. Mit gleichgroßem Gewicht werden viele andere Werke Humperdincks, die im Schatten stehen oder heute gänzlich ungespielt bleiben, beschrieben und nahegebracht. Dieser Erzählung angehängt sind äußerst nützliche Nachschlagerubriken wie eine Zeittafel, Zeugnisse (mit Auszügen aus Humperdincks Zeitungskritiken in Frankfurt aus den 1890er Jahren und Zeugnissen von und über Humperdinck), die zum Fließtext gehörigen Anmerkungen, ein Werkverzeichnis, eine Disko- und Videographie, eine Bibliographie und ein Personenregister.
Corvins Darstellungsmethode krankt etwas daran, dass er nicht vorwiegend mit eigenen Worten und in einem selbst gewählten Erzählduktus formuliert, sondern glaubt, für so viel Beschreibungen und Charakterisierungen wie möglich stets ein Zitat parat haben zu müssen, das er übernehmen und einsetzen kann. Die Fülle der Zitate und der herangezogenen Literatur ist zwar beeindruckend und führt auf interessante (Ab)Wege, aber der Erzählfluss hangelt sich des Öfteren zu sehr von Zitat zu Zitat. Auch hat er eine Sympathie für abgedroschene Klischees, die er oft an entsprechend passenden Stellen meint, nochmals anbringen zu müssen, so ist Goethe natürlich der „Weimarer Dichterfürst“, Rom die „Ewige Stadt“, Italien „die Wiege der abendländischen Kultur“ (was nun aber einfach falsch ist, denn das wäre wohl eher das antike Griechenland gewesen) und Richard Wagner selbstverständlich der „Meister von Bayreuth“, der aber ganz unmeisterlich sich von Humperdinck Gliederung und Länge der Verwandlungsmusik im 1. Akt des Parsifal in ein für die Bühnenarbeiten notwendigen Maß zurechtschneidern und vollenden ließ.
Unkommentiert bleiben auch Corvins Mitteilungen über einen interessanten, leider fragmentarisch gebliebenen theoretischen Versuch Humperdincks, in dem er das Moment des Plastischen im zeitlichen Fluss der Musik gegen musikästhetische Festlegungen von Eduard Hanslick hervorheben und die von Humperdinck oft eingesetzte Tonmalerei begründen wollte. Seltsam nur, dass Humperdinck diesen Traktat zu schreiben sich vornahm zu einer Zeit, als er mit Wagners Partitur des Parsifal beschäftigt war, einer passagenweise ausgesprochen zähflüssigen, nur akkordisch vorrückenden, fast statischen Musik. Die einseitige Betonung der Zeitlichkeit von Musik vergisst zudem, dass Musik natürlich als Schall, der zum menschlichen Ohr dringt, und gerade wegen einer möglichen Plastizität der Themen und Motive und raumgreifender Gesten durchaus ein auch räumliches Phänomen ist.
Die Erzählung Corvins von Humperdincks Lebensweg, seiner Ausbildung, seinen beruflichen Bindungen, seinen literarischen und musikalischen Vorlieben, so wie auch von seinen Reisen und längeren Auslandsaufenthalten (Spanien, Nordafrika, Amerika), ließen vermuten, dass Humperdinck hätte ein weltmännischer, kosmopolitisch eingestellter Musiker werden können; um so seltsamer berühren und enttäuschen seine bis zu antijüdischen Ausfällen sich steigernden zeit- und ortsgebundenen patriotischen, manchmal provinziell anmutenden Äußerungen und Stoffwahlen.
Dass der Verlag sich nicht in der Lage sah, ein gedrucktes Rezensionsexemplar zur Verfügung zu stellen, sondern dies schließlich vom Autor selbst bereitgestellt wurde, könnte man als üblen verlegerischen Scherz betrachten, ist aber bittere Wahrheit und zeigt den absoluten Tiefstand, den das gerne als Kulturnation auftretende Deutschland auf musikpublizistischem Sektor erreicht hat. Das analoge Lesen wird mutwillig zu Tode digitalisiert.
Peter Sühring
Bornheim, 22.08.2021
