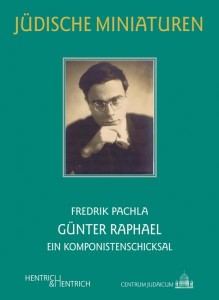 Pachla, Fredrik: Günter Raphael. Ein Komponistenschicksal. – Berlin: Hentrich & Hentrich, 2017. – 78 S.: zahlr. s/w-Abb. (Jüdische Miniaturen ; 204)
Pachla, Fredrik: Günter Raphael. Ein Komponistenschicksal. – Berlin: Hentrich & Hentrich, 2017. – 78 S.: zahlr. s/w-Abb. (Jüdische Miniaturen ; 204)
ISBN 978-3-95565-198-5 : € 8,90 (kt.)
Unvorstellbar ist die Summe der Verbrechen am jüdischen Volk. Und besonders vor dem Hintergrund der Eskalation im Holocaust mahnt uns die allgemeinmenschliche Erkenntnis: Jedes Opfer repräsentiert ein unverwechselbares Einzelschicksal – singulär und unwiederbringlich. Daran nachdrücklich zu erinnern, eignen sich vor allem jene Lebensläufe, die durch öffentliches Wirken und dessen Repression im Antisemitismus geprägt waren. Eine reichhaltige Palette von Schlaglichtern des jüdischen Lebens aus allen Sparten von Kultur, Politik, Wirtschaft, Philosophie oder religiöser Praxis erarbeitet Hentrich & Hentrich mit der von Hermann Simon betreuten Reihe Jüdische Miniaturen. Die trotz kürzlichen Erscheinens Oktober 2017 längst nicht mehr letzte Ausgabe Nr. 204 belegt mit der Auswahl des Komponisten Günter Raphael (1903-1960) einmal mehr die breite Streuung jüdischer Provenienzen sowie einzelfallabhängiger Fügungen und Reaktionsmuster seitens Tätern und Betroffenen unterm Hakenkreuz.
So war der Berliner Raphael selbst nicht Jude von Geburt, sondern durch Abstammung: Vater Georg hatte sich 22-jährig aus Überzeugung, nach familiärer Überlieferung aus Liebe zur Musik Bachs protestantisch taufen lassen. Zweite Besonderheit: Die nach schikanösem Berufsverbot drohende Deportation unterließ die SS auf ärztlichen Verweis, der schwer Tuberkulosekranke sei ohnehin dem Tode nahe.
Eingebettet in eine nach Maßgabe der Schriftenreihe kompakt erzählte Lebensbeschreibung hat dies und vieles mehr der Violinist und Musikwissenschaftler Fredrik Pachla, persönlich und fachlich prädestiniert durch einen engen familiären Bezug: die Ehe mit Raphaels Tochter Christine, die, ihrerseits renommierte Violinistin, bis zu ihrem Tod 2008 das Violinwerk Günter Raphaels kongenial aufgeführt sowie seinen Nachlass engagiert betreut hat. Nach dessen Übernahme gründete Pachla die „Christine Raphael Stiftung zur Förderung des Günter Raphael Gesamtwerkes“ und widmet seiner verstorbenen Frau nun die weitgehend aus ihren Erinnerungen schöpfende Vita.
Und deren fulminanter Start kam buchstäblich nicht von schlechten Eltern. Eigens referiert Pachla hier die väterliche und mütterliche Genealogie. Bilateral prägend für Günter Raphaels Reputation trafen sich beide Linien in der Heirat des Fabrikantensohns Georg Raphael mit der Tochter Maria seines Lehrers Albert Becker, der als Kompositionsprofessor an der Königlichen Akademie der Künste (prominentester Schüler: Jean Sibelius) und Leiter des Königlichen Domchores zu den Zelebritäten des wilhelminischen Musiklebens gehörte. Ebenso sachbezogen wie von der intensiven Begleitung durch die Mutter, die Günter nach frühem Tod des Vaters auf dem Weg von der Geige zu Bratsche und Klavier in die Welt der klassisch-romantischen Kammermusik einführte, erfährt man wertfrei auch von ihrem verzweifelten Versuch, angesichts des absoluten Berufsverbots ab 1939 „die Nazigrößen brieflich und persönlich, letztendlich jedoch erfolglos, von der deutsch-nationalen Gesinnung ihres Sohnes zu überzeugen“ (S 22), liest später auch von prominenter Unterstützung bei Raphaels vergeblicher Eigenbemühung um Aufnahme in die Reichsmusikkammer.
Die zuvor erreichte Höhe vor dem Rückfall stellt sich erstaunlicher dar als bis heute gemeinhin mit Raphael assoziiert: Nachhaltiger als ein weniger ergiebiges Berliner Studium war es Thomaskantor Karl Straube, Jugendfreund des Vaters, der dem mit Kammermusik, Lied und sakralen Chorwerken reüssierenden Zwanziger als Mentor den Weg nach oben bahnte – trotz kritischer Stimmen gegenüber seiner sichtbaren Brahms-Reger-Affinität. So kamen dank Straube Kontakte zu Arnold Mendelssohn und Paul Hindemith zustande, schließlich die Uraufführung der Sinfonie Nr. 1 durch Gewandhaus-Kapellmeister Wilhelm Furtwängler 1926. Vor Ort in Leipzig sicherte sich das Konservatorium den erst 23-Jährigen als Lehrenden, der Kurt Hessenberg oder Miklós Rózsa zu seinen Schülern zählen sollte und kompositorisch in kreativer Auseinandersetzung mit der deutschen Tradition einen neotonalen Individualstil im Kreis der Moderne fand.
Umso schmerzhafter schlug 1934 der nazideutsche Undank zu: Verlust der Leipziger Dozentur, künftige Abhängigkeit von Ausnahmegenehmigungen und privater Hilfe wie etwa durch Johann Nepomuk David. Eine Emigration mit seiner dänischen Ehefrau, der Pianistin Pauline Jessen, scheiterte an der frühzeitigen Geburt der ersten Tochter, die auf englischem Boden die Zuwanderung ermöglicht hätte. Kann Pachla den Wechsel nach Meiningen und dortige Querelen mit dem Thüringer Musikbeauftragten Ottomar Güntzel noch unter der Überschrift „Beginnende Ausgrenzung (1934-1939)“ subsumieren, steht das Folgekapitel „Ausnahmsloses Berufsverbot, Krankheit und Kriegsausbruch (1939-1944)“ neben der wohl lebensrettenden Transportunfähigkeit für jenen Schlüsselmoment in Raphaels Leben und Werk, in dem er – nunmehr im hessischen Idyll nahe Gießen – seiner Isolation einen positiven Impetus abgewinnen konnte. So habe er sich laut einem hier mehrfach zitierten Rundfunkvortrag „in diesen trostlosen Jahren zu einem einigermaßen eigenen Stil entwickelt, das war das einzig Gute an dieser stummen Periode meines Lebens.“ (S. 59)
Pachlas ebenso konzise, in ihrer persönlichen Anteilnahme sympathisch unprätentiöse Einblicke stimmen gerade im Blick auf die Nachkriegsstationen mit Professuren in Duisburg, Mainz und Köln durch ihre ungeschönte Perspektive nachdenklich. Näher skizziert erscheinen nun die auf hohem Arbeitsethos und festem Glauben gegründeten Charakterzüge des Musikschöpfers und beliebten Pädagogen, der nach schwerem Rückschlag und herben Enttäuschungen (Beispiel: Straubes früher Parteibeitritt) über seine physischen Grenzen hinaus der Musik diente, Humor und Selbstironie nicht verlernte, für seine künstlerische Rehabilitation das eigene Tun verantwortlich sah und in den Kollegien vor neuen atmosphärischen Problemen stand. Dem Leser bleibt die Frage: Wo stünde Raphael heute ohne den NS-Faktor? Ein Schlusskapitel zur stilistischen Entwicklung, die seit den späten vierziger Jahren zu einem „Tonalen Zwölfton“ vorstieß, und ein Verzeichnis der gedruckten Werke jedenfalls stehen imponierend für ein vielschichtiges Oeuvre, dessen Erhalt und Belebung eine garantiert lohnende Pflichtaufgabe markieren. Hörproben belegen es. Dem Gedenken auf breiterer publizistischer Basis helfe die Jüdische Miniatur Nr. 204!
Andreas Vollberg
Köln, 26.11.2017
