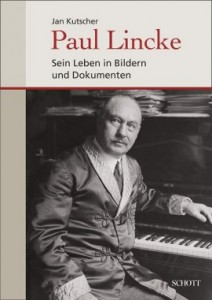 Kutscher, Jan: Paul Lincke. Sein Leben in Bildern und Dokumenten / Mitarb.: Sabine Westphal u. Heinrich Dreyhaupt. Mit e. Vorw. v. Albrecht Dümling – Mainz: Schott, 2016. – 327 S.: zahlr. s/w-Abb.
Kutscher, Jan: Paul Lincke. Sein Leben in Bildern und Dokumenten / Mitarb.: Sabine Westphal u. Heinrich Dreyhaupt. Mit e. Vorw. v. Albrecht Dümling – Mainz: Schott, 2016. – 327 S.: zahlr. s/w-Abb.
ISBN 978-3-7957-1084-2 : € 34,50 (geb.)
Verschmelzen ein oder zwei Evergreens mit ihrem Erfinder zu einem Begriff, so gerät dieser oft in Schieflage. Paradebeispiel: das Berliner Urgestein Paul Lincke (1866-1946), der dank unverwüstlicher Berliner Luft, Glühwürmchen-Idyll und der am provinziellen Operettenhimmel noch verstohlen leuchtenden Frau Luna die Riege wilhelminisch-preußischer Gassenhauermaestri anzuführen scheint. Doch das eindimensionale Bild verengt den Blick. Und dies betrifft nicht allein den Werkkatalog des Berliner Beamtensohns und nach Stadtpfeiferlehre in Wittenberge autodidaktisch professionalisierten Metierbeherrschers. Auch Linckes Persönlichkeit als politisch-unpolitischer Zeitgenosse und Popularkünstler gibt sich vieldeutiger als bis dato befunden.
Auf Spurensuche nach Faktischem und Unerforschtem begab sich nun Jan Kutscher, Lincke-Enthusiast und Leiter des Isola-Bella-Salonorchesters, mit exzellent präsentierten Ergebnissen, die weniger durch musikwissenschaftliche oder gar exegetische Brillen dämmern, sondern in hieb- und stichfester Quellen- und Zitierpraxis ungeschönt Kontur annehmen.
Eine nahezu ganzheitliche Analyse des Phänomens Lincke manifestiert sich allein in der Gesamtschau: Kutscher verschränkt die chronologische Anordnung mit einer thematischen. Zugleich stehen die biographischen Stationen, beredt durch vielerlei erstmals gesichtete Personal- und Behördendokumente, auf treffend recherchierten stil-, kultur- und zeitgeschichtlichen Grundsteinen.
Linckes nach geplatztem Militärmusiktraum gewagter Sprung ins florierende Berliner Varieté- und Theaterleben motiviert folgerichtig zu dessen gattungsgeschichtlicher Aufarbeitung. Die Voraussetzungen sind allgemein ökonomischer Art (neue Gewerbefreiheit) und sozial determiniert (Massenkunst im Industriezeitalter), werden auf Berliner Terrain dann speziell ausgeprägt dank der Linckeschen Talente, die ihn vom Fagottisten und Stabführer im Schweizer Garten und anderen Unterhaltungsbühnen zur exponierten Stellung als Kapellmeister und Komponist von 1893 bis 1897 am Apollo-Theater führten. Gestalt fanden sie hier, wie Kutscher plastisch definiert, im Erfolgsrezept einer ureigenen Form der Berliner Operette: zwischen Gesangsposse und Kurzoperette pendelnde Einakter, humoristische bis parodistische Skizzen großstädtischer Berliner Lebensart, garniert mit eingängigem Marsch und gemütvollem Walzer nach aktuellem Geschmack. Venus auf Erden, Lysistrata, Im Reiche des Indra gruppieren sich um den Renner Frau Luna (1899). Konsequent aufs Tapet kommen zugleich die landläufig verkannten Lincke-Facetten: Der als trivial beäugte Komponierstil ist nicht Unvermögen, sondern Methode. Bis zuletzt nämlich blieb Linckes angestammtes Fach das Couplet, das textbetonte Vortragslied mit erzählenden Strophen und Mitsingrefrain. Und statt dröhnender Spreeathener Selbstfeier bieten Linckes Bühnenwerke laut Kutscher in Wahrheit eine Spielart der von Offenbach inspirierten sozialsatirischen Buffoneske im Revueformat. Vollends überraschend, ja verstörend thematisieren einige der vielen vollständig zitierten Gesangstexte (mitunter auch vom Hauptlibrettisten Heinrich Bolten-Baeckers oder Lincke selbst) sozialkritische Sujets – besonders drastisch im von Julius Freund für Fritzi Massary gedichteten Dirnenlied über ein Verliererschicksal in Halloh! Die große Revue! (1909) aus Linckes kurzer Zeit am Metropol-Theater.
Eine Notiz wert sind Kutscher Linckes marginal gebliebene Musikbeiträge zu den ersten Experimenten des Filmpioniers Oskar Messter. Schärfere Schlaglichter fallen zunächst auf Linckes Produktion bis zur Weimarer Republik. Weltbekannt und gereist bis in die USA, sank sein Stern schon gegen 1910. Abendfüllend und wohlwollend aufgenommen, konnten Grigri und Casanova nicht mehr mit den frühen Zugstücken konkurrieren. Stilistisches Neuland wie ein American Cake Walk blieb Episode. Und sein Gespür für die Gefühls- und Stimmungslage im Reiche diktierte dem bekennenden Monarchisten mit dem sprichwörtlichen Kaiser-Wilhelm-Bart ab Beginn des Ersten Weltkriegs eine Reihe von säbelrasselnden Schlachtgesängen, nicht minder auch den Friedenswunsch der geschundenen Volksseele in die Feder. In der Weimarer Zeit scheint der Monarchist politisch angepasst. Musikpraktisch propagiert er vor dem Hintergrund der ausländischen und amerikanisch aufgefrischten Modewellen Kompromisslösungen zwischen jazzaffiner Tanzmusik und Salonstil aus eigener Werkstatt. Und in eigener Werkstatt kreiert Lincke sein persönliches Retro-Modell: das Recycling der einaktigen Erfolge zu mehraktigen Schlageroperetten mit musikalischer Austauschdramaturgie. Und jene Rolle des ergrauten Altmeisters, der auch an Pulten reichsdeutscher Großveranstaltungen die konservative Klientel der Kaiser-Nostalgiker bei Laune halten sollte, passte wie gerufen ins Kulturkonzept des NS-Regimes – ein von Lincke selbst billigend in Kauf genommener Imagenachteil bis heute. Diese irritierend „deutlich engagiertere Rolle Linckes beim Zugehen auf die nationalsozialistischen Machthaber“ (S. 12) diskutiert Kutscher besonders eingehend, differenziert und in der Quellenbehandlung offen kritisch, dabei respektvoll und fair. Diagnose ist das verhaltenstypische Muster eines nicht verfolgten, aber womöglich verängstigten Mitläufers mit Regimenähe aus Karriereinteressen, der sporadisch Kontakte zu jüdischen Kollegen weiterpflegte, dann gegenüber den Siegermächten NS-Kontakte, namentlich zum Kulturfunktionär Hans Hinkel, herunterspielte.
Die thematischen Kapitel beleuchten – viel Licht, viel Schatten – das private wie geschäftliche Persönlichkeitsprofil. Den kaufmännischen Profi in seinem Element verrät ein Exkurs zum von Lincke aktiv geförderten Urheberrecht: Anstatt sich den Verlegern auszuliefern, wurde Lincke früh deren Kollege und Spitzenverdiener mit seinem Apollo-Verlag, profitierte zudem recht krisenfest durch seinen Beitritt zur französischen Verwertungsgesellschaft SACEM. Neben großherziger und liebenswürdig-bescheidener Selbstdarstellung dokumentiert zumal ein „Frauen“-Kapitel die auch eitlen bis narzisstischen Kehrseiten des lebenslangen Galans und Skatbruders u.a. von Richard Strauss. Zum Durchbruch kamen sie nach kurzer Ehe in mehr und minder stabilen Liaisons mit Theaterangestellten geringerer Prominenz, die sich letztlich nicht in Linckes bürgerliches Ideal eines Heimchens mit Repräsentationsaufgaben fügten. Die Kulmination vom Rosen- zum Paragraphenkrieg schließlich durchlitten – protokolliert in einem „Steuer“-Kapitel – die Diener des Fiskus, denen der von seiner Erlesenheit Überzeugte gnadenlos im Kampf um Werbungskostenpauschalen zusetzte.
Einige Blätterarbeit erfordert der reichhaltige Fußnoten-Anhang. Im angenehmen Lesefluss besichtigt man zugleich aber eine Fotodokumentation, die in ihrer medialen Vielfalt ebenso das Zeug zur denkwürdigen Ausstellung hätte.
Andreas Vollberg
Köln, 13.07.2017
