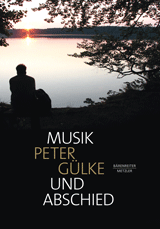 Gülke, Peter: Musik und Abschied. – Kassel u. Stuttgart: Bärenreiter u. Metzler, 2015. – 362 S.: Notenbeisp.
Gülke, Peter: Musik und Abschied. – Kassel u. Stuttgart: Bärenreiter u. Metzler, 2015. – 362 S.: Notenbeisp.
ISBN 978-3-7618-2377-4 (Bärenreiter) u. 978-3-476-02564-7 (Metzler) : € 29,95 (geb.; auch als e-Book)
Auf dem Titelblatt steht wahrhaftig: Musik Peter Gülke und Abschied – passend zu dem symbolhaften Titelfoto von Karoline Gülke. In der Tat ist dieses Buch eines, das im Persönlichen kreist – mehr noch, als der Leser es sonst von Peter Gülke, diesem eigenwilligen und eigentümlichen Grenzgänger zwischen Musikmachen, Musikdenken und Musikbekennen, gewohnt ist. Im ersten Kapitel noch in die Distanz der dritten Person gerückt, ist es im Schlusswort beim restituierten Ich angekommen; dazwischen schreitet es in konzentrischen Kreisen den Versuch des Abschiednehmens aus, ausgelöst durch den Tod der Ehefrau.
Nicht jeder hat die Möglichkeit, eigenes Leid so reflektiert an einem Gegenstand abzuarbeiten, der lebenslang der Versicherung des Selbst gedient hat. Insofern ist Gülkes Position privilegiert: Er kanalisiert seine Trauer, indem er ihr in Musik nachspürt. Dass der Leser hier nicht belehrt, nicht erbaut, sondern mit hineingenommen wird in das verbindende kathartische Andere, sei vorausgeschickt. Wer die Kompositionen nicht kennt, keine klangliche Vorstellung mit dem verbindet, was Gülke auswählt, mit literarischen Assoziationen wie „des Schrecklichen Anfang“ keinen Rilke zu verbinden weiß, sondern umfassende Werkinformationen oder gar Quellenangaben sucht, kurz: wer sich auf die Wege, Umwege und Perspektivverschiebungen des Persönlichen nicht einlassen mag, wird den Texten verständnislos entgegenstehen. Gülke nutzt „das Privileg der Alten, nicht mehr konkurrieren zu müssen, auf Mitwelt kaum noch angewiesen zu sein“ (S. 319) – oder, mit den Worten des Philosophen Odo Marquard: „Ich verlasse mich, je älter umso mehr, auf das eigene Verschwinden und Verklingen und kann gerade dadurch ungehemmt sehen und sagen: so ist es. Meine Mitmenschen nämlich, denen ich das zumute, brauchen dafür [...] nur noch ein wenig Geduld, denn binnen kurzem sind sie mich los“ (S. 318). Dieser scheinbare Egoismus des Alters ist zugleich von der Hoffnung durchdrungen, noch letzte Worte zu sagen und die Essenz des Gelebten weiterzugeben.
Anders gesagt: Zwar ist Peter Gülke schon von jeher ein Vermittler gewesen, der mit Klängen und Worten ebenso wie mit der eigenen Person für seine Sicht der Musik einsteht, doch so privat, so hermetisch war er wohl nie. Dass das Buch dennoch weit mehr ist als ein Katalysator für den eigenen Schmerz, liegt daran, dass die Auslöser des Buches allgemeingültig sind: der Verlust eines geliebten Menschen, die beharrlichen Vorboten des Alters, die Frage nach dem „Wem hab‘ ich gesammelt“ aus Schillers Don Carlos.
Das klingt nun recht abstrakt, ist es aber nicht. Vom „Lob des Wiederhörens“ (S. 330) mag das Buch wohl auch heißen, denn Gülke kreist hier ein, was ihm musikalisch lebensbegleitend ist: Wort- und Gedankengänge über Musik, ausgelöst durch Musik, aber stets rückfragend auf den Menschen. Nach der fast literarisch distanzierten Ausgangssituation an der Leiche der Verstorbenen beginnt er mit Schubert und richtet im Weiteren mit Palestrinas Missa Papae Marcelli, Rilkes Todes-Erfahrung oder Wagners Tristan Wegmarken auf, die im Nach-Denken Selbstvergewisserung und schonungslose Selbstbefragung vereinen: „Tristan wird auch zum Lehrstück über die Unverfügbarkeit des Todes: Jeder stirbt für sich allein“ (S. 262). In kursiver Schrift fallen Reflexe der realen Trauerphasen dazwischen: „Ganze Tage mit Dingen beschäftigt, die jeder sinnvoll und nützlich finden würde; trotzdem leere Tage, oft wie in einem Vakuum zugebracht: Hinter allem, was er tut, wie er lebt, fragt ein Wozu“ (S. 279). Aber: „Es gibt einen Hochmut von Trauernden – ich als Ausnahmefall geehrt durch den Hieb, der mir verpasst worden ist“ (S. 16). Das ist schon wieder so fern der eigenen Betroffenheit, dass es wie eine Ohrfeige demjenigen gilt, der sich nicht rational einem gelingenden Abschiednehmen entgegenarbeitet.
Dass Gülke es fertigbringt, Trauer, Selbstdistanzierung und Musik ineinanderzuschieben und in der Reflexion von musikbezogenen Sachverhalten Leidbewältigungsstrategien anzubieten – so persönlich sie auch immer sind –, ist die Stärke dieses Buches. Dabei entsteht eine Art Konzertführer, dessen Werkauswahl ganz subjektiv Meilensteine einer „Musikgeschichte des Abendlands“ umreißt und diese in immer neuen Varianten als klingende Metamorphosen des Abschiednehmens deutet. Was außerhalb dieses Fokus liegt, wird ausgeblendet.
Was (und wie) Gülke hier durch die Brille des Finalen zum Sprechen bringt, zeigt nicht mehr und nicht weniger, als dass es Objektivität im Menschlichen schlichtweg nicht gibt – wieviel weniger noch Wahrheit. „Was aber ist Wahrheit in der Musik außer Musik selbst?“ fragt Gülke im letzten, Schostakowitsch gewidmeten Kapitel. „Nicht einmal das, was Komponisten beim Komponieren mit ihr sagen wollten, selbst wenn es sie inspiriert hat“ (S. 342).
Dass die zu Sprache geronnene Musik zumindest Träger individueller Wirklichkeiten sein kann, schimmert durch. Dass dies aber nirgendwo anders geschieht und gelingt als nur und ausschließlich im Hörenden, bezeugt Gülkes Buch mit einer einnehmenden Kompromisslosigkeit. „Der Mensch ist immer mehr, als er von sich weiß“, befindet der Philosoph Karl Jaspers. Und Gülke zeigt, wie sich dem Mehr-von-sich-wissen-wollen des Fragenden im Dialog mit der Musik Antworten anbieten. Keine absoluten Wahrheiten, aber Antworten, mögliche, immerhin … und damit letztlich vielleicht doch Wahrheiten – im Sinne von Jaspers: „Wahrheit ist, was uns verbindet.“
Leseprobe incl. Inhaltsverzeichnis
Kadja Grönke
Oldenburg, 24.03.2015
