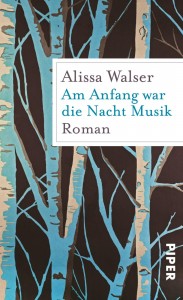 Walser, Alissa: Am Anfang war die Nacht Musik. Roman. Sonderausgabe – München: Piper, 2012. – 268 S., Abb. (Serie Piper ; 7387)
Walser, Alissa: Am Anfang war die Nacht Musik. Roman. Sonderausgabe – München: Piper, 2012. – 268 S., Abb. (Serie Piper ; 7387)
ISBN 978-3-492-27387-9 : € 10,00 (geb.)
Bisher ist auf Alissa Walsers 2010 erschienenen Debütroman nur in literaturkritischer und sprachästhetischer Hinsicht oder in Bezug auf die Hauptfigur des Romans, den bis 1878 in Wien, dann in Paris lebenden und wirkenden Magnetiseur Franz Anton Mesmer (1734–1815), reagiert worden. Darum ist vielleicht das Erscheinen von dessen 2. Auflage in Form eines leinenkaschierten Taschenbuchs im Geschenkbuchformat ein geeigneter Anlass, einmal auf die musikalische Seite dieses Romans und die zweite Hauptfigur, die Pianistin, Komponistin, Sängerin und Musikpädagogin Maria Theresia Paradis (1759–1824) und ihre Darstellung durch Walser einzugehen. Bereits ein Jahr vor Erscheinen des Romans hatte Julia Hinterberger auf dem Salzburger Paradis-Kongress ihre Abrechnung mit der bisherigen literarischen Paradis-Rezeption unter das Motto „Märchen, Mythen, Halbwahrheiten“ gestellt. Hat Walser mit ihrem Mesmer-Paradis-Roman nur eine weitere derartige Kalamität produziert oder hat sie sich wenigstens der bis zum Erscheinen ihres Romans bekannt gewordenen musikhistorischen Forschungsergebnisse bedient, um nicht nur einem narrativ-ästhetischen Kitzel über eine blinde, nicht therapierbare Musikerin nachzujagen?
Über eine solche Frage erweist sich Walsers Roman allerdings als erhaben oder vielmehr als resistent; denn diese Autorin hat die Lehren aus Wolfgang Hildesheimers Ende der Fiktionen gezogen und spielt mit Wahrheit und Lüge derart halsbrecherisch, dass ihre Lügen ehrlicher sind als die Wahrheit oder als jegliche den Tatsachen gerechte Behauptung es je sein könnte. Sie schreibt keine fiktive Biografie, sondern sie beschreibt die Vorkommnisse in Wien im Frühjahr 1777 zwischen den Häusern des Hofsekretärs Paradis und dem Mesmers in dem Wiener Vorort Auf der Landstraße allesamt als Fiktionen, seien sie nun historisch verbürgt oder nicht. Denn Walser geht es um etwas ganz anderes als historische Korrektheit, nämlich die Interpretation eines Ausnahmezustands, der Musik heißt. Das Portrait der Musikerin Paradis (Tochter aus gutem, dem kaiserlichen Palast nahestehenden Hause mit tyrannischen, ehrgeizigen Eltern, die nicht nur wollen, dass Maria Theresia als Pianistin berühmt wird, sondern auch den Makel, blind zu sein, verliert) ist ganz bezogen auf ein schillerndes, zunächst ambivalentes, dann eindeutig und einseitig werdendes Verhältnis von Licht und Dunkelheit. Ihre musikalische Begabung, ihre Hingebung an die Musik ist ganz darauf gestellt, dass sie in der Schwärze der Nacht gewachsen ist und auch nur dort weiter gedeihen kann.
Sehenden Auges spielen zu lernen, bedeutet für sie, den erworbenen Tastsinn auf der Tastatur wieder zu verlieren und wieder von vorne anfangen zu müssen, Musik nun unter Einfluss der Helligkeit spielen zu lernen. Das wirft die radikale Frage auf, was einem Musiker das mitunter grelle Licht, das Sehenkönnen überhaupt bedeuten kann (oder angeblich muss). In Zeiten anerkannter Dominanz des Sehens über das Hören, behauptet und exemplifiziert die Autorin: Für diese Musikerin namens Paradis zumindest war das Sehen als fünfter Sinn nicht nur entbehrlich, sondern wurde als störend empfunden. Nach der gewaltsam abgebrochenen, zunächst (wenn auch zäh und langsam) erfolgreichen Magnet-Therapie in der Anstalt Mesmers sinkt die Paradis in ihr Paradies der Blindheit, in dem sie glänzend musizierte, zurück, und beginnt ihre bis heute bekannte Karriere. Erst diese Negativ-Kur erschließt ihr das Positive ihres mühsam erworbenen Zustands musikalischer Produktivität in der Dunkelheit. Ob damit von der Autorin (im nicht ausgeprochenen Anschluss an E.T.A. Hoffmann) die Nachtseite als die der Musik generell adäquate Sphäre bezeichnet sein will, bleibt dahingestellt. Es ist aber ein Exempel dafür – entgegen aller zuwiderlaufenden Meldungen aus unseren nachgeborenen Zeiten einer audiovisuellen Synthese – dass Musik, dass emphatisches Musizieren des Lichts, des Sehens, der Sichtbarkeit der Dinge nicht bedarf.
Angesichts dieser großartigen, mit vielen poetischen Bildern und anmutigen, auch deftigen Dialogen untermauerten Erkenntnis (die trotz der kurzatmigen, lakonischen anakoluthischen Sätze nie abgehackt wirkt) wiegen solche Kleinigkeiten, wie die, dass es im Wien des Jahres 1777 keine bekannte und spielbare Violinsonate in G-Dur von Wolfgang Amadé Mozart gegeben haben konnte, weil er die gemeinte erst ein Jahr später in Mannheim komponierte, gering, sie dürfen als kleine Notlügen passieren. Dafür gibt es einen wunderbaren Traum von einer Begegnung mit Mozart, der u.a. auch das fast glücklich zu nennende Schicksal der Paradis mit dem von Mozarts Schwester assoziativ in Beziehung setzen lässt, jener anderen Maria (Anna), die nicht Pianistin und Komponistin werden konnte, obwohl ihr Bruder sie für mehr als begabt dazu hielt und die sehenden Auges in eine ihre künstlerische Laufbahn zerstörende Ehe schlitterte. Auch die überlieferten grotesken Perücken, die sie trug, erinnern an die, die Walser der Paradis aufsetzt und von denen sie sich während der Therapie befreite. Sie wollte und kam nicht unter die Haube aus Licht, sondern blieb die blinde Musikerin, als die sie sich herangebildet hatte. Am Ende war die Musik der Nacht hörig. Auch Mozart komponierte nicht nur eine kleine, sondern viele große Nacht-Musiquen.
Peter Sühring
Berlin, 19.08.2012
