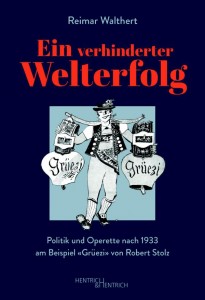 Reimar Walthert: Ein verhinderter Welterfolg. Politik und Operette nach 1933 am Beispiel „Grüezi“ von Robert Stolz. – Berlin [u.a.]: Hentrich & Hentrich, 2022. – 163 S.: 22 s/w-Abb.
Reimar Walthert: Ein verhinderter Welterfolg. Politik und Operette nach 1933 am Beispiel „Grüezi“ von Robert Stolz. – Berlin [u.a.]: Hentrich & Hentrich, 2022. – 163 S.: 22 s/w-Abb.
ISBN 978-3-95565-520-4 : € 24,90 (Klappbroschur)
Zurück auf die Bühnen und hinein in die Aufnahmestudios! Erfolgreich motivierte dieser Appell zu manchem Comeback verfemter oder vergessener Meisterwerke der Operette. Denn oft zeigte sich beim Studium der Originale, zumal denen aus jüdischer Feder, dass hier ein erheblich frischerer Wind wehte, als es eine biedere und affirmativ verkitschte Aufführungstradition in den Nachkriegsjahrzehnten suggeriert hatte. Anzukreiden ist diese Misere maßgeblich jener restriktiven und antisemitischen Kulturpolitik der NS-Zeit, die den Wesenskern des zu Weimarer Zeit mit Revue- und Filmelementen modernisierten Genres verfälschte und ihr unsinniges Konzept eines von Gesellschaftskritik, Frivolität, Erotik und Undeutschem gereinigten Volksmusiktheaters krachend vor die Wand fuhr.
Wenig Liebe widmen große Bühnen und Labels infolge notorischer Fehleinschätzung bislang allerdings dem Österreicher Robert Stolz (1880–1975), dessen Popularität bis heute einseitig auf ausgekoppelten Einzelnummern gründet. Einen gewaltigen Impuls für eine absolut lohnende Renaissance setzt nun der vielseitige Schweizer Musiker, Musikologe, Dirigent, Gymnasiallehrer, Kulturmanager und Physiker Reimar Walthert mit einer Untersuchung zu einem weitgehend vergessenen Erfolgswerk namens Grüezi von 1934. Gleichziehen wollten Stolz und Co-Autoren hiermit einen Kassenschlager, den auch Stolz mit zwei unverwüstlichen Ohrwürmern musikalisch bereichert hatte: Ralph Benatzkys Salzkammergut-Hommage Im weißen Rößl von 1930.
Zwar überzeugt Waltherts Werkmonographie allein durch Präsentation, systematischen Aufbau und minutiös erarbeitete Statistiken, zugleich aber herrscht kein Mangel an Leserfreude über amüsante Kommentare und überraschende Pointen. Völlig unbeschönigt wiederum kommen die verheerenden Folgen der NS-Kulturpolitik auf den Tisch. Für Waltherts Pioniergeist spricht zumal die referierte Quellenlage: kaum Sekundärliteratur, verstreutes Material in Nachlässen und Archiven, ergiebig dagegen Presseberichte und – in weiten Teilen – Theaterstatistiken.
Überraschend, aber sinnvoll steht vor der Entstehungsgeschichte die Werkbetrachtung. Schließlich „entstehen“ variabel aufgeführte Werke wie Revueoperette oder Musical erst kontinuierlich und formal im Fluss durch Erprobung und Veränderung nach der Uraufführungsserie. Und Parallelen zum Musical diagnostiziert Walthert anhand der Arbeitsteilung im Autorenteam: Stolz, Karl Heinrich David (Komponist schweizerischer Einlagen), Robert Gilbert (Liedtexte) sowie Armin L. Robinson, Karl Schmid-Bloss und Jakob Rudolf Welti (Buch), deren Gros durch Pseudonyme getarnt blieb. Zwar rechnet Walthert Grüezi bei Analyse von Orchestrierung und musikalischer Dramaturgie der Revueoperette zu, distanziert sich jedoch deutlich von deren qualitativer Abwertung: Als Reaktion auf eine durch Schematisierung ausgelöste Operettenkrise bediene sie sich der Schnitt- und Collagetechnik des Films, orientiere sich in frech-karikierendem Habitus und Doppelbödigem mithin noch eher an Offenbach als die Wiener Operette. Stichhaltig widerspricht er auch pauschalierenden Befunden angeblicher Trivialität. So enthalte auch Grüezi opernnah durchkomponierte Passagen sowie sozialkritische oder antimilitaristische Statements in den Texten Gilberts.
Einstweilen ging die Rechnung auf: Erfolgssicher mit folkloristischen Stücken und Uraufführungsproduktionen deutscher Exiloperetten, ist Intendant Schmid-Bloss am Zürcher Theater eine sichere Bank. Die Premiere wird zum Großereignis der Theaterwelt, eigens gründen die Autoren einen Musikverlag, und auch in Luzern, St. Gallen oder Basel rangiert das Weiße Rößl à la Suisse auf Spitzenplätzen. Simpel: die Story um Hotelier Blümli mit seinen drei – nach Nationen getrennt – wohlerzogenen Söhnen, die es, vom Militärdienst heimkehrend, amourös auf des Vaters Sekretärin und Angebetete Gretli abgesehen haben, bevor sie sich dann zum Glück anderweitig in drei angereiste „Mareien“ aus Paris, Mailand und Wien verlieben. Gritli aber kommt ehelich – nach traditionellen Operettenkomplikationen – mit dem Regisseur eines Filmteams zusammen. Aufwendig: das Drumherum mit Revuebildern, Trachten und Tanzsequenzen. Auf den Hype aber reagierte eine von Heimatschutzbünden befeuerte Pressekampagne, die Sturm lief gegen die vermeintliche Beschmutzung Schweizer Nationalehre und dafür sorgte, dass die Eidgenossen Grüezi Adieu sagten.
Dem Kapitel zur Entstehung zugerechnet werden sodann auch die internationale Resonanz in Nachbarländern bis hin nach Skandinavien unter diversen, irritierenden Umbenennungen (österreichisch: Servus) sowie die mediale Verbreitung. Der kulturhistorisch essentiellste Zielpunkt aber folgt, wenn Grüezi als Beispiel für das Schicksal der Operette im Dritten Reich in den Fokus rückt. Dezidiert geht es um die Gleichschaltungspraktiken der Reichskulturkammer und die ambivalenten Taktiken des Reichsdramaturgen Rainer Schlösser. Ein offizielles Verbot von Grüezi erfolgt zunächst durch den Ausschluss jüdisch geführter Unternehmen aus der Vereinigung der Bühnenverlage, den Stopp von Devisenflüssen in die Schweiz sowie Skepsis gegenüber den Tarnnamen der Texter. Am Braunschweiger Theater gelang es 1938 kurioserweise, „die Reichsdramaturgie an der Nase herum zu führen“ (S. 104) und das Stück als Himmelblaue Träume auf die Bühne zu lancieren, worauf prompt ausgerechnet das Berliner Theater des Volkes nachzog. Das Aus kam erst 1940 mit dem Verbot der Werke des emigrierten Stolz, der sich als Nichtjude einer Vereinnahmung durch die Nazis widersetzte.
Vorbildlich informativ und präzise definiert ein Exkurs die entscheidenden Aspekte der bis in die Nachkriegszeit fortgesetzten Verwässerung der Gattung Operette unter NS-Ägide. In diesem Fahrwasser setzte eine stark verfremdende NWDR-Einspielung 1954 Maßstäbe im negativen Sinne: Bühnen winkten ab oder verkannten das originale Potential. Ambitionierte Aufführungen in den letzten Jahrzehnten beschränkten sich auf reduziert besetzte Dimensionen – „höchste Zeit“ also, „dass wir (…) den Faden dort wieder aufnehmen, wo die produktive Phase“ der Operette „in den 1930er Jahren des 20. Jahrhunderts gewaltsam beendet wurde.“ (S. 150)
Andreas Vollberg
Köln, 01.04.2023
