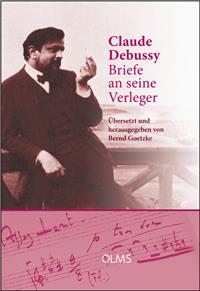 Claude Debussy. Briefe an seine Verleger / Übers. u. hrsg. von Bernd Goetzke. Mit einem Geleitwort von Denis Herlin. Im Anhang Auszüge aus den Erinnerungen von Jacques Durand (1924/1925). – Hildesheim [u.a.]: Olms, 2018. – 476 S.: Abb., Notenbeisp. (Musikwissenschaftliche Publikationen ; 47)
Claude Debussy. Briefe an seine Verleger / Übers. u. hrsg. von Bernd Goetzke. Mit einem Geleitwort von Denis Herlin. Im Anhang Auszüge aus den Erinnerungen von Jacques Durand (1924/1925). – Hildesheim [u.a.]: Olms, 2018. – 476 S.: Abb., Notenbeisp. (Musikwissenschaftliche Publikationen ; 47)
ISBN 9-783-487-085-975 : € 38,00 € (geb.)
Was der Olms-Verlag im 100. Todesjahr des französischen Komponisten Claude Debussy vorlegt, kann für das deutsche Lesepublikum ohne Übertreibung als eine Sensation bezeichnet werden. Leider versteckt sich diese verlegerische Großtat hinter einem derart unspektakulären, ja Ermüdung verheißenden Titel, dass es wirklich schade darum ist! Zwar bezieht sich dieser auf die erste entsprechende Briefpublikation aus dem Jahre 1917, Lettres de Claude Debussy à son éditeur von Jacques Durand. Aber diese Anspielung dürfte den meisten Lesern wohl zunächst verborgen bleiben. Der Titel erweist sich zudem in mehrfacher Hinsicht als Understatement. Zwar benennt er korrekt den Hauptteil der vorliegenden Veröffentlichung – aber es geht hier keineswegs um eine trockene Verlagskorrespondenz, die die Publikation von Partituren flankiert. Vielmehr dokumentieren Claude Debussys Briefe an seine Verleger „das gesamte Berufsleben des französischen Komponisten und zugleich eine musikhistorisch und politisch bewegte Epoche zwischen Fin de siècle und Erstem Weltkrieg“ (Verlagstext).
Aus den 442 erhaltenen und hier komplett übersetzten Briefen des Komponisten an Jacques und Auguste Durand, Georges Hartmann, Eugène Fromont, Julien Hamelle, Paul de Choudens sowie an die Verlagshäuser Enoch und Schott erwächst ein ganzes Panorama von Zeit- und Musikgeschichte, gefiltert durch die Sicht eines sensiblen, aber auch sarkastischen Beobachters und Akteurs. Debussys Briefe geben Aufschluss über die Entstehung, Aufführung und oft auch herbe Kritik an einzelnen Werken, über die Gepflogenheiten des Pariser Musiklebens und malen ein authentisches und zugleich zwiespältiges Bild der Epoche und ihres schreibenden Protagonisten. Damit sind sie eine Art persönliches Äquivalent zu einer Biographie vom Typus „Leben und Werk“, oder wie der Übersetzer und Herausgeber Bernd Goetzke in seinem Vorwort formuliert: „Wir erleben Debussy hier in zahlreichen ,Funktionen‘: natürlich als Komponisten, aber auch als Freund, Lebensgefährten, Familienvater, Denker, kritischen Kommentator und Zeitzeugen. Und die beiden Geißel seines Lebens, die finanzielle Not und die Krankheit, treten dabei in zunehmend dramatischer Weise in den Vordergrund“ (S. 13).
Über Debussys Verlegerbriefe hinaus umfasst der umfangreiche, solide aufgemachte (und mit 38,- Euro erfreulich erschwingliche) Band die leider nur neun erhaltenen Gegenbriefe sowie zwei Schreiben an seinen Freund Robert Godet (der wohlgemerkt kein Verleger war), sowie ein Briefkonvolut an die zweite Ehefrau Emma, das nicht nur über Debussys Russlandreise von 1913 Auskunft gibt, sondern auch „eine Art Momentaufnahme“ (S. 419) der nicht einfachen Ehe darstellt. Es folgt ein berührender Brief, den Debussys 12‑jährige Tochter Claude-Emma (hier durchgehend mit ihrem Kosenamen „Chouchou“ geführt) wenige Tage nach dem Tod des Vaters an ihren Halbbruder Raoul Bardac schrieb. Weit über Verlagsangelegenheiten hinaus gehen auch die Auszüge aus den Erinnerungen von Jacques Durand, die Debussys Hauptverleger, Mentor und Freund 1924/25 unter dem Titel Quelques souvenirs d’un éditeur de musique publiziert hat. Diese gewichtigen, gleichwohl als „Anhang“ deklarierten 48 Seiten, machen neugierig auf alle anderen, ca. 1.550 erhaltenen Briefe des Komponisten, die zusammen mit ca. 1.000 Gegenbriefen 2005 in Paris komplett ediert wurden.
Das Schwergewicht der vorliegenden deutschen Ausgabe liegt auf dem Briefwechsel mit Durand. Beim Lesen wird deutlich, dass der in der Öffentlichkeit eher spröde Debussy zu Durand – den er lebenslang siezte – eine aufrichtige Freundschaft pflegte, die sich in einer sehr persönlichen, geistreichen und oft ausgesprochen witzigen und selbstironischen Korrespondenz niederschlug. Hier erfahren wir nicht nur Wesentliches über den Menschen, sein Leben in all seinen Höhen und Tiefen und über sein Umfeld, sondern wir erkennen auch, mit welcher zutiefst sympathischen Unsicherheit, Selbstkritik und Skrupulosität der Komponist bisweilen um seine Musik rang, bevor er sie zur Veröffentlichung freigab, oder mit welchen Banalitäten des Alltags er sich herumschlug. Dabei kam dem Briefwechsel mit dem Freund gelegentlich eine geradezu kathartische Wirkung zu, denn Debussy gestaltete beim Schreiben die Bizarrerien des Alltags zu humorvoll zugespitzten kleinen Szenerien um. So schrieb er beispielsweise am 8. Juni 1908 über Proben zu seiner Oper Pelléas et Mélisande: „Miss. M. Teyte hat nach wie vor nur etwa die Emotionalität einer Gefängnistür, sie ist weit davon entfernt, eine Prinzessin zu sein [...]; [der Sänger] Dufrane schreit“ (S. 193). Und am 24. März desselben Jahres formulierte er mit kennzeichnender Selbstironie: „Mein lieber Jacques, letzten Sonntag war das Wetter zauberhaft, um mit Freuden nichts zu tun … Und genau dieser Tag war es, den – von der Höhe seiner Weisheit herab – M. Ph. Flon [Direktor der Oper in Lyon] wählte, um mich den kompletten Pelléas spielen zu lassen – mit zahllosen Wiederholungen – Gott, der sich um einen Haufen Nichtsnutze kümmert, ist nicht nett zu den Musikern! Ph. Flon hat wechselweise so ausgesehen, als ob er versteht oder ertrinkt … schließlich ist er gegangen, sehr zufrieden mit meinem Tag, und mich hat er mit einem beschädigten Daumen der rechten Hand zurückgelassen – das kommt vielleicht von den vielen Nonen, die diese Partitur enthält und die man mir so verschiedentlich vorgeworfen hat“ (S. 188).
Solche Einblicke in den Alltag eines Musikers, der Bitterkeit in Skurrilität umwandelte, um sich vor vermeintlichen oder realen Bedrängnissen zu schützen, wären bereits lesenswert genug. Und dennoch waren sie in deutscher Sprache bislang nicht zu erhalten. An Primärquellen zu Debussy lag lediglich eine übersetzte Auswahl der Musikkritiken vor (Reclam 1982: Monsieur Croche), was eine eigenständige deutsche Debussy-Forschung nicht gerade gefördert hat. Dabei war Debussy lebenslang ein lebhafter, inspirierter und kreativer Schreiber (und Leser)! Bei der Lektüre des neuen Olms-Bandes wird allerdings deutlich, dass die Zurückhaltung in Sachen deutschsprachiger Publikationen von (und zu) Debussy nicht nur mit dem nicht unkomplizierten Charakter des Komponisten zu tun hat: Ein Hauptgrund mag auch in der Sprache dieser Briefe selbst liegen, die so ganz aus der Situation heraus, aus dem inneren Universum des Schreibers gestaltet ist. Da gibt es Anspielungen an Situationen und Personen, die diesseits des Rheins kaum verständlich erscheinen, Sprachspiele, die nur dem Musiker und dem Muttersprachler zugänglich sind, und private Subtexte, die kaum erläuterbar wirken. Dazu arbeitet der Schreiber virtuos, ja geradezu musikalisch mit der Sprache und seiner oft sehr eigenwilligen Assoziation einzelner Wörter, nimmt es mit Namensschreibungen und Zeichensetzungen nicht allzu genau, amüsiert sich über Menschen und Ereignisse und nicht zuletzt über sich selbst in verwegenen Bildern: „Pardon für den Schreibstil einer kranken Katze“ (S. 374). Wie soll man eine derart persönliche Redeweise auch nur annähernd ins Deutsche bringen, ohne entweder wortgetreu, aber unverständlich zu werden, oder bei zu großer Freiheit den ursprünglichen Sinn zu verfehlen?
Angesichts solcher Hürden kann man den Anteil des Übersetzers an dieser Publikation gar nicht genug würdigen: Bernd Goetzke, eigentlich als feinfühlender Pianist und engagierter Klavierdozent bekannt, hat hier als Musikwissenschaftler und Übersetzer Überragendes geleistet. Zweisprachig aufgewachsen, hat er gar nicht erst versucht, die Vorlage Wort für Wort ins Deutsche zu bringen. Er gestaltet nach, sucht hinter dem Gesagten das Gemeinte und macht die Essenz sodann in kongenialen deutschen Formulierungen nachvollziehbar. Das Ergebnis ist eine sprachlich runde, gut lesbare und dennoch zuverlässige Adaption der französischen Texte. Und als sei das noch nicht genug, schöpft Goetzke aus seiner profunden Kenntnis von Leben, Werk und kulturellem Umfeld und bezieht dies alles in Form von Einzelstellen-Kommentaren in seine Übertragung mit ein. Mithilfe dieser knappen Erläuterungen werden Debussys Briefe auf mustergültige Weise verstehbar. Darüber hinaus überträgt Goetzke auch die Kommentare aus den bisherigen französischsprachigen Briefausgaben von 1927, 1980 und 2005, sodass sich in den Anmerkungen die historische und die gegenwärtige Sicht wechselweise ergänzen und bereichern.
Auch die bescheiden „Vorbemerkungen des Übersetzers“ betitelte Einleitung erweist sich als ein profunder Text, der mit bewundernswürdiger Verbindung von Knappheit und Informationsfülle, Sachwissen und Empathie Wesentliches zu Debussy auf den Punkt bringt. Unter dem Leitgedanken des „Widersprüchlichen Genies“ (S. 13) verfolgt Bernd Goetzke hier die roten Fäden von Debussys Leben und Charakter durch seine Korrespondenz hindurch. Zugleich gibt er dem Mitherausgeber der französischen Briefgesamtausgabe von 2005, Denis Herlin, die Ehre des initialen „Geleitworts“ und dem allerersten Briefherausgeber, Durand, post mortem, das Anrecht auf das „Vorwort“. Sorgfältig durch Brief-Chronologie, Werk- und Personenregister erschlossen, ist dieser Band alles andere als eine trockene Lektüre über die Publikation von Musik, wie die Titelgebung anfangs befürchten ließ. Nein, es ist ein Lesebuch, das neben dem Künstler auch den Menschen, Familienvater und Freund Debussy lebendig und facettenreich vor das innere Auge treten lässt – und dessen Kenntnis zweifellos das Hören seiner Werke verändert und bereichert.
Inhaltsverzeichnis
Kadja Grönke
Oldenburg, 15.12.2018
