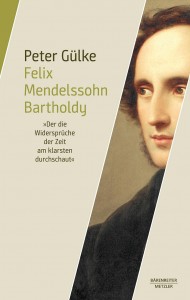 Gülke, Peter: Felix Mendelssohn Bartholdy. „Der die Widersprüche der Zeit am klarsten durchschaut“ – Kassel: Bärenreiter, 2017. – 140 S.: Notenbsp., Abb.
Gülke, Peter: Felix Mendelssohn Bartholdy. „Der die Widersprüche der Zeit am klarsten durchschaut“ – Kassel: Bärenreiter, 2017. – 140 S.: Notenbsp., Abb.
ISBN 978-3-7618-2462-7 : € 30,00 (geb.)
Nun hat Peter Gülke ein weiteres Buch in seinem unverkennbaren Stil veröffentlicht, voll mit bildungsbürgerlichen Geistreicheleien und Anspielungen, wie immer verblüffend sprunghaft und assoziationsreich, und es wird wieder ein begeistertes deutsches Lesepublikum finden. Seine im Klappentext gepriesene „unnachahmliche Sprachkraft“ führt, mindestens genau so oft wie sie Klarstellungen dient, aber auch zu neuen Vernebelungen. Oft hilft Gülke ein neutrales „es“, um Satzanschlüsse grammatikalisch verunglücken zu lassen und den Sinn zu verfinstern. Oft wird dort, wo der Rekurs auf Fakten gefragt gewesen wäre, die sich hätten ermitteln lassen, wild spekuliert und dort, wo triftige Spekulationen gefragt gewesen wären wie bei der Entschlüsselung dessen, was Schumann mit den „Widersprüchen der Zeit“, die Mendelssohn durchschaut und gelöst haben soll, gemeint haben könnte, nur mit der Achsel gezuckt. Insofern ist dieses Buch mehrdeutig blendend; es ist für Liebhaber gestelzter und raunender Prosa blendend geschrieben, oft aber verblendet von einer selbstverliebten Perspektive auf den Tonkünstler Mendelssohn, und es ist das Buch eines rhetorischen Blenders.
Schön und brauchbar ist Gülkes Widerstand gegen die viel besprochene, Mendelssohn angedichtete kompositionstechnische „Glätte“; großzügig, dass er meint, selbst wenn es diese Glätte bei Mendelssohn gäbe (er kann hundertmal beweisen, dass es sie nicht gibt), wäre sie kein Makel. Aber Gülke verkehrt diesen berechtigten Widerstand in sein nichtswürdiges Gegenteil: in eine Fürsprache für Mendelssohns (hundertmal von ihm bewiesenen) Störungen, Verstörungen, Fragmenthaftigkeiten, Formeln des Scheiterns, des Nicht-Ankommens, der Verweigerung etc. und dämonisiert dies auf deutscheste Art, um Mendelssohn in den Chaos-Klub der Genies zwischen Beethoven und Wagner heimzuholen. Das ganze garniert mit der anzüglichen Konnotation an die jüdische Sphäre, dies sei „ahasverisch“.
Das Einleitungskapitel, in dem er etliche dümmliche musikfeuilletonistische Pointen und auf Unkenntnis von Mendelssohns Musik basierende, dünkelhafte Äußerungen höchster musikphilosophischer Autoritäten wie Adorno & Co. als „Irritationen“ zitiert, also auch solche Zitate wie „fröstelnder Klassizismus“ (Adorno über Mendelssohn) oder „armselig“ (Bloch über Mendelssohn) bringt, ist eigentlich überflüssig, denn diese snobistische Mendelssohn-Schelte sollte einen souveränen Mendelssohn-Kenner keine Sekunde lang irritieren. Aber Gülke ist nicht souverän, er arbeitet sich eloquent an Musik und Person Mendelssohns ab, und dieses Buch ist sein geschöntes Abarbeitungs-Protokoll.
Bei Gelegenheit des Adorno-Zitats muss nebenbei auch die schlampige Art des Nachweisens kritisiert werden. Ist schon die auch bei Gülke waltende akademische Unsitte, nur noch aus Gesamtausgaben und deren Band-Nummern zu zitieren, ohne gefälligerweise die einzelne Schrift beim Namen zu nennen, die in dem besagten Band mitabgedruckt ist, peinlich genug, führt hier die Angabe in den Anmerkungen: „Adorno 1984“ zu dem Literaturhinweis: „Gesammelte Schriften in 18 Bänden“ (desgleichen bei Nachweisen zu Freud- und Heine-Werken). Na dann, viel Spaß beim Suchen, für den Fall, dass irgendjemand wirklich das Umfeld von Adornos Unsinn über Mendelssohn nachzuschlagen wünschte und für Mendelssohns Werke den getreuen Korrepetitor spielen wollte auf der interessierten Recherche nach dessen klassizistischen Stellen oder Konzeptionen. Das Zitat müsste übrigens im Band 17 (Musikalische Schriften, Band IV) zu finden sein und würde somit aus einer der beiden relativ weit verbreiteten Aufsatz-Sammlungen Adornos, Moments musicaux oder Impromptus stammen, in denen also vielleicht auch ein Nichtbesitzer der Adorno-Gesamtausgabe (solche gebildete Menschen soll es geben) zuhause nachschlagen könnte, ohne in eine Bibliothek gehen zu müssen, wenn er denn die Einzelschrift genannt bekommen hätte.
Gülke gelingen hermeneutische Kunststücke einer innermusikalischen Poetik, z.B. wenn er gleich im 2. Kapitel seine eigene Interpretation des späten zerklüfteten f-Moll-Streichquartetts folgen lässt, das eher einen frösteln machenden Anti-Klassizismus repräsentiert und vor Themen- und Motivgestalten überquillt, welche jegliche Sonatenform-Schablone zertrümmern. Gezielt geht Gülke vereinzelt über die Beschreibung des inneren Getriebes der von Mendelssohn komponierten Musik hinaus und wagt es, ein Symbol für etwas Außermusikalisches dingfest zu machen, das erfreulich ambivalent bleibt. Aber selbst in diesem Kapitel ist es (wie oft bei Gülke) so, wie es der von ihm zitierte Kafka gesagt hat: „Richtiges Auffassen einer Sache und Mißverstehen der gleichen Sache schließen einander nicht vollständig aus“. Nur, dass Gülke beides in seiner Person vereinigt. Denn anstatt darauf zu verweisen, wie im späten f-Moll-Quartett, dem zerrütteten Nekrolog auf Fanny, etliche frühere derartige Anwandlungen bei Mendelssohn traurige Urständ feiern, soll dieses Quartett das Tor zu einer neuartigen, bei Mendelssohn bisher ungehörten Musik aufgeschlagen haben, was wohl nur die halbe Wahrheit ist.
Einer der größten Irrtümer, denen Gülke penetrant unterliegt (den er aber mit sehr vielen andern Musikern teilt), ist die Rede von Mendelssohn als einem „konvertierten Juden“ oder „Konvertiten“. Was für eine Musik hätte Mendelssohn denn als Konvertit komponieren sollen, wo er doch gar keiner war? Um es für die in Sachen Judentum notorisch schlecht unterrichteten Musikhistoriker nochmals klarzustellen: Das Judentum muss einem (um es, Männer betreffend, in den Worten des jüdischen Religionsphilosophen Franz Rosenzweig zu sagen) „angeboren, anbeschnitten, angegessen, angebarmizwet sein“. Felix Mendelssohn war von Geburt Jude (und zwar einzig und allein wegen seiner jüdischen Mutter Lea, geb. Salomon), wurde aber nicht beschnitten, aß im Hause Mendelssohn nicht koscher und kam statt in die Bar Mizwa in den evangelisch-reformierten Konfirmationsunterricht, der (abgesehen von evtl. Beobachtungen der Lebensweise seiner jüdischen Großmütter und Großtanten) seine erste Berührung mit Religion darstellte, nachdem er (wegen des Indifferentismus seines Vaters und der Ablehnung bestimmter, ihr barbarisch erscheinender Traditionen der mosaischen Religion vonseiten seiner Mutter) als bisher areligiöses Wesen aufgewachsen und im Alter von 7 Jahren christlich getauft worden war, ohne je in die Synagoge gegangen oder den Sabbat geheiligt zu haben. Von der ihm angedichteten Konversion keine Spur.
Gülkes oft zu lesende Sätze von gut gedrechselter Schönheit und scheinbarer, nur gewollter Schlüssigkeit verdanken sich oft irrigen Spekulationen, die sich lediglich an eine Fehlinformation, ein Klischee, eine Halbwahrheit wortgewaltig anknüpfen. Den als „mirakulös“ bezeichneten Anschluss des jungen Mendelssohn an die Art und Weise des späten Beethoven setzt er in Kontrast zum konservativen Unterricht bei Zelter. Wo aber bleibt hier der zweite, für Mendelssohn in bestimmter Hinsicht viel wichtigere Lehrer Ludwig Berger, der dem jungen Felix die Freiheit gewährte, sich mit Haydns, Mozarts, Schuberts und Beethovens Art vertraut zu machen? Berücksichtigt man diese Erfahrungen des Jünglings, erscheint die Sache etwas weniger mirakulös und löst sich die legendäre und einseitige Fixierung auf Zelter, die nicht der Lebenswirklichkeit Mendelssohns entsprach, auf und entlarvt sich als das, was sie ist: eine interessierte Legende der autoritätsfixierten Musikgeschichtsschreibung. Denn, wer war schon der heute fast vergessene Ludwig Berger gegen die tradierte selbsternannte Autoritätsperson Zelter, Direktor der Sing-Akademie zu Berlin? Dennoch ist die wundersame Physiognomie von Mendelssohns Klaviersonate op. 6 ohne den Einfluss Bergers unerklärlich.
Schade auch, dass Gülke seine musiksprachlichen Auslegungskünste gerade im Fall der sogenannten Reformationssinfonie (zugegeben sei, Mendelssohn habe selbst diesen Namen auch einmal erwogen) nicht auf die dringend aufklärungsbedürftigen, musikalisch interessanten, geistlichen und weltlichen Ingredienzien der ersten drei Sätze dieser Symphonie spirituelle wirft, sondern nur auf die Frage, warum der 4. Satz, der als einziger sich direkt auf reformatorisches Musikgut bezieht, missraten musste.
Neben vielen nachvollziehbaren Erkenntnissen und vereinzelten neuen Sichtweisen auf Mendelssohns Musik (dazu zählen jene auf die Liedhaftigkeit seiner meisten Themen, die große Potenz an Traurigkeit und Spielfreude, auf riskanten Einsatz irregulärer Formelemente), welche die bisherige Rezeption gegen den Strich bürsten, fehlen wichtige Aspekte (Mendelssohns musiktheatralische Elemente in Oper, Schauspielmusik und Oratorium, sowie große Teile der Kammermusik) fast ganz, dafür entführen Gülkes metaphysische Spekulationen in traditionelle Gefilde deutscher Werkbetrachtungen, die selbst einen Mendelssohn noch versuchen, kunstreligiös zu überhöhen.
Typisch für Gülkes Denkstil einer thematischen Verschleifung nicht zusammenhängender Dinge ist das Kapitel: „Die Familie, oder: Hat er es zu leicht gehabt?“ Hier wird die berüchtigte Frage nach der angeblich unbeschwerten und privilegierten Kindheit und Jugend des Felix Mendelssohn vermischt nicht nur mit der Frage nach dem Grund für seinen frühen Tod, sondern auch (weil Reichtum und Judentum angeblich stets zusammengehören) mit der Frage seines religiösen Bekenntnisses. Die wirklichen Lebensverhältnisse der Mendelssohns nach ihrer Übersiedelung von Hamburg nach Berlin waren zunächst, in der Bartholdyschen Meierei vor dem Schlesischen Tor, in der Markgrafenstr. und auf der Neuen Promenade in der Wohnung von Leas Mutter Bella Salomon (alles, bevor man im 15. Lebensjahr Felixens das „Stadtpalais“ in der Leipziger Str. bezog) nicht sonderlich großbürgerlich zu nennen und kein Anlass für (der Vergleich musste ja kommen) Wagnerschen Sozialneid.
Die über die Mendelssohn-Kinder verhängte christliche Taufe war ein Schritt im Geist eines gesellschaftshörigen Opportunismus, denn dem vernunftreligiösen Agnostiker Abraham Mendelssohn lagen im Grunde die Riten und Dogmen des Christentums genauso fern, wie eine Rückkehr zu den Riten und Dogmen eines orthodoxen oder aufgeklärten Judentums. Insofern war der Schritt zur christlichen Taufe nicht, wie Gülke meint, „leichter“ oder „weniger groß“ als der Schritt, in die familiäre, aber gesellschaftlich geächtete Glaubenstradition von Fromet und Moses Mendelssohn oder Bella Salomon zurückzukehren, gewesen wäre. Auch die christliche Taufe war, verglichen mit dem aufgeklärten Humanismus, zu dem Abraham sich bereits durchgerungen hatte, ebenfalls ein Rückschritt zur Religion, allerdings zu einer, die in seinen Augen „nichts enthält, was Euch [seine Kinder] vom Guten abhält“ was so ziemlich das Mindeste (oder sogar schon das Höchste) ist, was sich von Christentum sagen ließe. Elemente der mosaischen Religion, die einen Menschen vom Guten abhalten könnten, nannte Abraham Mendelssohn nicht; fraglich bliebt, ob er sie hätte nennen können. Auffällig auch hier, dass Gülke diese Fragen, hübsch deutsch-christlich-patriarchalisch als Fragen zwischen Großvater, Vater und Sohn abhandelt, Großmutter mütterlicherseits und Mutter (auch sie einer Jüdin Tochter, die keine Jüdin mehr sein wollte) tauchen nur am Rande auf, obwohl Leas Ablehnung barbarischer Elemente des Judentums und Bellas Verteidigung der jüdischen Orthodoxie viel entschiedener waren als Abrahams tolerante Indifferenz.
Verglichen mit den realen innerfamiliären Verhältnissen der Mendelssohns kann man Gülkes assoziationsreich gekünsteltes Reden über diese Dinge nur als haltloses Bramarbasieren bezeichnen, das weitgehend auf Gerüchten und illegitimen Verknüpfungen basiert. Auch der verdächtige Gebrauch des in schlecht informierten Kreisen verbreiteten unsinnigen Wortes „alttestamentarisch“ statt alttestamentlich spricht für sich. Erschreckend, dass im 21. Jahrhundert in Deutschland immer noch so über Mendelssohns allmählich und selbstbewusst erworbene und lebenslang festgehaltene und auch musikalisch ausgelebte christliche Religiosität gesprochen wird, die sich, gerade weil sie evangelisch-reformiert geprägt war, verschiedenen Konfessionen (auch der jüdischen) zuwenden konnte. Für diese Fragen hätte man sich ein Lektorat gewünscht, das dem Autor hätte „die Leviten lesen“ können. Diese Entgleisungen werden auch durch das vorletzte, 25 seitige und damit längste und dicht argumentierende Kapitel über Mendelssohns geistliche Musik nicht wettgemacht, in dem wieder wunderliche Dinge über das Christentum zu lesen sind.
Im Kapitel über Fanny Hensel, geb. Mendelssohn (Die große Schwester) wird die Verwirrung fast unentwirrbar. Hier wird alles verquickend so getan, als hätte Felix Mendelssohn seinen Aufstieg einem Judenbonus zu verdanken gehabt (denn der nichtjüdische adelige Bürger Hans von Bülow habe es nicht so schnell geschafft) und das Zurückbleiben Fannys in der musikalischen Berufswelt (wegen des Widerstands von Vater und Bruder) hing für Gülke auch irgendwie damit zusammen, dass Felix seine Konvertiten-Allüren, seine „Ranschmeiße“ an die christlich-deutsche Mehrheitsgesellschaft auf ihre Kosten praktizierte. Das macht ungefähr so viel Sinn wie die Behauptung, Gustav Mahler hätte seiner Frau Alma das Komponieren verboten, weil er von Überanpassung an das Christentum besessen gewesen wäre. Der jüdisch-christlich-islamische Patriarchalismus, der Frauen aus künstlerischer und wissenschaftlicher Tätigkeit ausschließt, war zur Zeit von Moses bis Felix Mendelssohn in Deutschland noch ungebrochen und selbst Abraham Mendelssohn konnte sich im Rahmen seiner profanen Humanitätsideen nicht von ihm trennen. Wenn man beim Thema der Assimilation an Felix Mendelssohns Verhalten etwas beobachten kann, dann, dass er trotz aller Benachteiligungen, Anfeindungen, Niederlagen und Enttäuschungen relativ gleichmütig geblieben ist und sich in seinem Arbeitsverständnis und seiner Musik aller eifernden Konvertiten-Allüren und Apologetik enthielt, seiner Wege ging, sich sarkastisch abwandte oder schwieg und ausschließlich auf sein wohl erworbenes Künstlertum baute. Als Ausgleich für die Blindheit Gülkes, dies nicht gesehen zu haben, überinterpretiert er dann hellseherisch Zelters harmloses Wort vom „Judensohn, der aber kein Jude ist“ (was, wenn man es auf Religion bezieht, sachlich fast richtig ist und noch besser auf Vater Moses und Sohn Abraham passen würde) als judenfeindlich.
Obwohl relativ schmal, ist dieses Buch zu vollgestopft, um in einer kurz zu haltenden Rezension in all seinen dicht gesäten verqueren Aspekten und Kapiteln diskutiert zu werden. Aber der souveräne, kritische Leser, den dieses Buch verdient, um aus seinen Fehlern zu lernen, wird diese Diskussion selber führen können, sofern er sich der Mühe unterziehen will, durch Gülkesche Nebelschwaden zu wandeln.
Es ist immer gefährlich (manche finden es auch peinlich), wenn ein Interpret schlauer sein will als der Schöpfer des zu interpretierenden Werkes. Nach eigenem Bekunden ist Gülke das Risiko eingegangen, Mendelssohns Musik – für ihn die Musik eines „zwar nicht bekennenden, doch immer noch Juden“ (S. 126) – bei seinem Versuch, möglichst tief in sie hineinzuhören, „anders zu verstehen, als er verstanden sein wollte“ (S. 127). Wozu soll das gut sein?
Peter Sühring
Berlin, 10.01.2018
