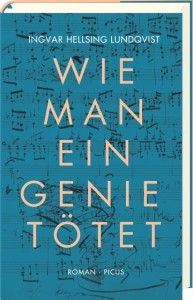 Ingvar Hellsing Lundqvist: Wie man ein Genie tötet. Roman / Aus d. Schwed. übers. von Jürgen Vater – Wien: Picus, 2019. – 309 S.
Ingvar Hellsing Lundqvist: Wie man ein Genie tötet. Roman / Aus d. Schwed. übers. von Jürgen Vater – Wien: Picus, 2019. – 309 S.
ISBN 978-3-7117-2074-0 : € 24,00 (geb.; auch als e-Book)
Da nennt ein Lehrerkollege Ende der 80-er Jahre den großen Johannes Brahms doch glatt einen „Scheißkerl“! Kann, wer solches hört, daraus auch noch das Thema eines ernsthaften literarischen Wurfs gewinnen? Er kann. Der Schwede Ingvar Hellsing Lundqvist, nach Literatur- und Philosophiestudium zunächst mit Erzählungen hervorgetreten, fand dank dieser ungewöhnlichen Initialzündung zu seinem bemerkenswerten Romandebüt. Denn die wenig pietätvolle Brahms-Schelte kam nicht von ungefähr. Wenig publik ist die Tatsache, dass auch der Großmeister seinerseits eine Leiche im Keller hat: den mentalen Kollaps des genial begabten Bruckner-Schülers Hans Rott (1858-1884). Dessen zukunftsweisenden sinfonischen Erstling, eingereicht als Bewerbung um das österreichische Staatsstipendium, hatte Kommissionsmitglied Brahms, der in melodischen Zitaten und Anspielungen ironische Spitzen vermutete, coram publico in Grund und Boden verdammt. Für den ohnehin kaum solventen und gesundheitlich angeschlagenen Zwanziger nahm das Martyrium seinen Lauf – bis zum frühen Tod mit knapp 26 Jahren in völliger Umnachtung. Seine Sinfonie E-Dur aber, die visionär das universalistische Konzept und die stilistische Handschrift seines Studienfreundes Gustav Mahler berührt, fand nach über 100-jährigem Schlummer den Weg ins Repertoire und ins Augenmerk der kritisch wertenden Musikwissenschaft.
Deren Befassung mit Rotts Schicksal und limitiertem Œuvre ließen Lundqvist nicht mehr los. Gerade die Tragik und die Fallhöhe von idealistischer Fremd- und Selbsteinschätzung gegenüber widrigsten gesellschaftlichen und gesundheitlichen Rückschlägen erzwangen einen emotionalen, von intensiver psychologischer Einfühlung geleiteten Zugang. In der personalen Innenschau und direkten Dialogführung zwangsläufig fiktiv, wirken die skizzierten Ereignisse und Begebenheiten nach Lage der Überlieferung realistisch und wirklichkeitskompatibel, plakativ durch prägnante Syntax, gepaart mit einer von Jürgen Vater überwiegend subtil ins Deutsche übertragenen Poesie. Dramatik und Drastik hin oder her. Wo es politisch und kulturell gärte wie im Wien vor 1900, ging es auch im Leben der geistigen Wortführer turbulent zur Sache – musikalisch mit dem Parteienstreit zwischen Neudeutschen pro Bruckner versus Traditionalisten um Brahms.
Anerkennend registriert man, dass der Weg ins Elend der Erkrankung nicht voyeuristisch als kulminierende Absturzbahn eines Antihelden instrumentalisiert wird: Gleich an erster Stelle konfrontiert Lundqvist mit jenem ohnehin notorisch kolportierten Vorfall auf Rotts Zugfahrt Richtung Mülhausen zum Antritt einer zugesagten Chorleiterstelle. Mit vorgehaltenem Revolver zwang er sein rauchendes Gegenüber zum Löschen der Flamme. Brahms habe den Wagen mit Dynamit gefüllt. Überwältigt von Bahnpersonal und Polizei, ging die Reise in fest geschnürter Zwangsjacke zurück nach Wien, dort indes ins psychiatrische Klinikum.
Das Bild des Hans Rott, menschlich und primär künstlerisch, erschließt sich dann in der Tendenz chronologisch. Eingebettet sind sämtliche Aspekte und Fakten in lebendig dynamisierte Episoden, Szenen, Gedankengänge oder Rückblicke. Rückblicke Rotts gelten, als die Misere mit Veräußerung des elterlichen Inventars längst nagt, dem Bühnenunfall des als Schauspieler prominenten Vaters Carl Mathias Rott im Theater an der Wien und dem Trauma nach dem frühen Tod der Mutter Maria Rosalia Lutz inmitten arbeitsintensiver Gesangskarriere auf Wiens Operettenbühnen.
War Hans vorehelich geboren, stammt sein Halbbruder Karl einem Verhältnis der Mutter mit Erzherzog Wilhelm von Österreich und liefert Hans neben familiärem Rückhalt reichlich amourös verursachten finanziellen Kummer und Konfliktstoff um symbolhafte Familienschmuckstücke wie Kreuz und Porträt der Mutter oder das vom Herzog an den Vater verliehene Goldene Kreuz. Der blaublütige Deutschordensritter selbst reflektiert bei einer unterkühlten Begegnung mit Karl auf Diskretion um der Ehre willen. Einziger Obolus des Erzeugers: ein sattes Schweigegeld. Entlastung für den auch an der Handelsschule ausgebildeten Hans bringt erst Karls Schauspiel- und Kapellmeisterengagement in Krems.
Hans Rotts geistige Prägungen illustriert Lundqvist in getrennt exponierenden Stationen. Marx‘ Gesellschaftsutopien, Nietzsches Ideen vom Übermenschen, Vegetarismus, Wagners Kunstwerk der Zukunft etwa schäumen zwischen dem späteren SPÖ-Begründer Victor Adler, dem Philologen Friedrich Löhr und weiteren Heißspornen im „Roten Hahn“ ebenso lebendig auf wie das reichlich konsumierte Bier, bevor Hans sich selbst messianisch zum Schöpfer der neuen Sinfonie ausruft. Bier erweist sich auch als Elixier des Rott aufopferungsvoll zugewandten Anton Bruckner. Dessen skurril fromme und devote Züge entgehen bei Lundqvist trotz Typisierung der klischeehaften Überspitzung – auch beim liebevoll gezeichneten Besuch mit Rott und den enthusiastischen Wagner-Adepten in Bayreuth, wo Bruckner dem Hochverehrten bei einem nächtlichen Fässchen seine Dritte ans Herz legt.
Hans Rott liest Bjørnstjerne Bjørnson, Schopenhauer und – Nietzsche. An dem enttäuscht ihn die Gottesverneinung. Schließlich ist ihm der religiöse Antrieb Herzensangelegenheit. Das Göttliche aber wünscht er sich weiblich. Überhaupt hält er das Wesen der Frau für das vernunftbegabtere. Offenherzig bekennt er dies wie auch seine Marienverehrung gegenüber seinem Vertrauten Vater Anselmus, dem er zwei Jahre lang als Organist bei den Piaristen Gott via Musik offenbart, sich nach falscher Verdächtigung eines Autographendiebstahls aber vergrätzt zurückzieht. Die Kontrastierung seiner Sympathien wie etwa für Anselmus mit dem stocksteifen Gehabe der Konservatoriumsoligarchen umschifft auch hier die Klippe des Extrems. Gleichwohl gelingt die bizarre Persiflage der Gegnerclique: allen voran Direktor Joseph Hellmesberger als eitler Zyniker, dem der Kopfsatz von Rotts visionärer Schöpfung nicht einmal einen Trostpreis und das vertragliche Abgangsstipendium wert ist. So spiegelt sich glaubhaft das imaginierte Empfinden Hans Rotts, der seine Schöpfung, über der das Konservatoriumsorchester kläglich scheitert, schon in metaphysischen Sphären sah: „Mit den Sternen schweben, eine himmlische Spieldose mit Tönen klingen lassen, die nie zuvor gehört worden waren.“ (S. 74)
Wirtschaftlich über Wasser halten ihn eine bald verbrauchte Erbschaft, wiederholte freundschaftliche Almosen des Philologen Joseph Seemüller und Klavierstunden in betuchteren Kreisen. Alltagsbegebenheiten (Beobachtung eines Bettlerpaars, Verlust des geschenkten Hundes Fides) unterstreichen zusätzlich das Leben in Armut. Impressionen der musikalischen Ideenfindung schöpfen vielfach aus romantisierenden Naturbildern in Rotts nachgelassenen Briefen. Leitmotivisch trübt und mystifiziert Nebel in vielerlei Varianten die Szenarien, stiften Fiaker einen Wiener Genius loci. Romantisierend ebenfalls: der Topos Blau für die Farbe eines bzw. gefühlt aller Kleider Louises, Schwester von Friedrich Löhr und Bertha, Rotts Schülerin. Hans‘ und Louises leidenschaftlichen Eheplan durchkreuzt der Vater mit Blick auf Hans‘ unsichere Künstlerexistenz und die winkende Partie mit einem vermögenden Salzhändler, mag Louise auch noch so emanzipatorisch ihr Talent zur professionellen Malerin in die Waagschale werfen.
Nicht ohne Pathos, auch mit satirischen Nadelstichen Richtung Brahms-Partei, multiperspektivisch präludierend, nämlich aus Sicht des Mannes, „der einen Komponisten töten sollte“ (S. 185, 188, 190), nebst Mitgutachter Karl Goldmark und dem egomanen Kritikaster Eduard Hanslick, braut sich das unheilvolle Tribunal über jenes Opus zusammen, das Rott hoffnungsvoll für das Staatsstipendium eingereicht hatte. Auch die letzte Chance, eine Aufführung durch den Dirigentenpapst Hans Richter, versandet auf unbestimmte Zeit. Der differenzierter urteilende Goldmark plädiert für eine Revision. Doch als Rott die späte Kunde vom Gewinn des Preisgeldes ereilen soll, befinden wir uns längst im letzten Drittel der betrüblichen Künstlervita: der Leidenszeit in der Niederösterreichischen Landesirrenanstalt nach besagtem Vorfall im Zug. Rotts forcierte Halluzinationen kulminieren in einer apokalyptischen Entscheidungsschlacht zwischen Rottschen und Brahmsschen Kampftruppen. Und als obsessives Menetekel drapiert ein schwarzer Engel nicht nur die Nachricht vom Ableben Karls. Den ungeschönten Realismus menschenunwürdiger Unterbringung psychisch Kranker entnahm Lundqvist historischen Quellen wie Nellie Blys Ten Days in a Mad-House von 1887 oder Literatur zum Anstaltsleiter Ludwig Schlager. Statt auf die behandelnden Kapazitäten fällt ein wärmeres Licht auf jenen einfühlsameren Assistenzmediziner, dessen prominenter Name – Synonym für den Aufbruch der Psychoanalyse – erst in einer lieblosen Instruktion des leichenfleddernden Gehirnanatoms Theodor Meynert verbaliter fällt. Dunkel färbt sich auch die Stimmung für Bruckner und die besuchenden Freunde. Als Witzfigur und zur Tanzbelustigung klimpernder Kauz von Mitpatienten verhöhnt, stirbt Hans Rott absehbar nach einigen Tagen rapider Schwächung.
Wenn Bruckners Grabesrede voll Wucht mit Brahms ins Gericht geht, glaubt man ein distinguiertes Vorzitat des für Lundqvist motivierenden „Scheißkerl“ zu vernehmen.
Überraschend katapultiert ein investigativer Epilog ins 21. Jahrhundert. Nicht überraschend endet Lundqvist mit Gustav Mahlers Rott-Nekrolog: „Was die Musik an ihm verloren hat, ist gar nicht zu ermessen: zu solchem Fluge erhebt sich sein Genius schon in der Ersten Symphonie, (…) die ihn (…) zum Begründer der neuen Symphonie macht, wie ich sie verstehe.“ (S. [310])
Andreas Vollberg
Köln, 12.06.2019
