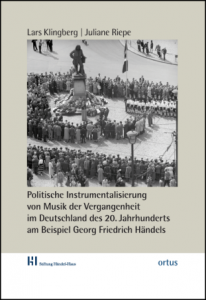 Lars Klingberg und Juliane Riepe: Politische Instrumentalisierung von Musik der Vergangenheit im Deutschland des 20. Jahrhunderts am Beispiel Georg Friedrich Händels. – Beeskow: ortus, 2021. – 701 S.: Abb., Notenbsp. (Studien der Stiftung Händel Haus ; 6)
Lars Klingberg und Juliane Riepe: Politische Instrumentalisierung von Musik der Vergangenheit im Deutschland des 20. Jahrhunderts am Beispiel Georg Friedrich Händels. – Beeskow: ortus, 2021. – 701 S.: Abb., Notenbsp. (Studien der Stiftung Händel Haus ; 6)
ISBN 978-3-937788-67-8 : € 89,00 (geb.)
Das Schicksal Georg Friedrich Händels ist hier nur ein Exempel für jenen öffentlichen und kulturpolitischen Vorgang, den die Autoren der vorliegenden Studie in Abwägung gegen andere mögliche Begriffe, also mit Bedacht: politische Instrumentalisierung nennen. Warum sich Händel dafür besonders eignet, bleibt ein wunder Punkt seiner Musik, und es ist eine kleine Schwäche dieser gewichtigen Untersuchung, dass sie die Frage, ob und wenn ja, warum spezielle Teile von Händels Musik ihrem Missbrauch Vorschub leisten, kaum ausführlich genug erörtert. Wer allerdings glaubt, nur in Diktaturen wäre so etwas möglich und nötig, wird hier schnell eines Besseren belehrt, denn der historische Bogen, den die Analysen dieses Phänomens spannen, reicht vom Kaiserreich über die Weimarer Republik, das Nazi-Reich, die DDR, die alte BRD bis in jüngere Tage eines wiedervereinigten Deutschlands und den neuesten Moden, auch musikalische Kunstwerke der Vergangenheit nach wohlmeinenden politischen Interessen oder auch nur solchen eines sogenannten Regietheaters umzudeuten, zu vergewaltigen oder auszulöschen.
Moralische Empörung, die schon in dem von den Autoren nicht verwendeten Wort Missbrauch mitschwingt, ist nicht Gegenstand, Absicht oder Ziel dieser Analysen, sie wird dem Leser überlassen, wenn ihm danach zumute sein sollte. Hier geht es um etwas ganz anderes, nämlich die Funktionsweise von Funktionalisierung der Musik für politische Zwecke zu verstehen. Erkenntnisgewinn auf ganzer Linie verspricht diese Untersuchung und löst ihn glänzend schrittweise anhand aufgerollter Fragestellungen und in vielen Fallstudien ein. Das rührt von der methodischen Vorsicht und Sorgfalt her, mit denen die Autoren zu Werke gingen. In einer minutiös argumentierenden Einleitung werden die Weichen für die Lektüre gestellt, indem die Erkenntnisse nüchtern und den Leser ernüchternd vorweg resümiert werden. Sie klingt wie eine Ouvertüre, von der man ahnt, dass der Komponist sie zum Abschluss seiner Oper komponiert hat.
Man betrachtet kritisch die Wege, die die politische Instrumentalisierung der Musik Händels nimmt, betrachtet die Vorgehensweise ihrer Akteure, ihre Weltanschauung als Beweggrund für dieses Vorgehen, betrachtet den Widerstand, der zum Teil von den vereinnahmten Werken selber ausgeht und von Menschen, die inmitten der staatlich verordneten Instrumentalisierung nicht angepasst funktionieren. Möglichkeiten und Grenzen politischer Übergriffe auf Musik sollen aufgezeigt werden; für die auf Händel gibt es ein schier unübersehbares Material, sodass sie sich besonders gut für eine Darstellung, Interpretation und für generalisierende Schlussfolgerungen eignen, die auch auf den Umgang mit anderen Komponisten und deren Werken übertragbar sind.
Denn das Spezifische politischer Ideologien ist, dass sie untereinander in ihrem Absolutheitsanspruch nicht differieren, dass sie in den angewandten Methoden zur Durchsetzung und Selbstbehauptung ihrer Macht sich kaum unterscheiden, weswegen sie zwar immer noch nicht gleichgesetzt werden dürfen, aber vergleichbar werden. Und so ist die fruchtbare Methode, die in diesen Recherchen benutzt wurde, eine komparatistische und neutrale, die ideologische Verengungen zu vermeiden sucht. Die Autoren selbst haben für ihre Schlussfolgerungen keinen Absolutheitsanspruch, sondern gestehen zu, dass man mit anderen Methoden und Einstellungen zu anderen Ergebnissen kommen könnte, aber die Klarheit und Einsichtigkeit ihrer Resultate spricht für sich. Und so ist nicht nur ihr immenser Fleiß zu loben, sondern auch der Scharfsinn ihrer Analysen. Frappierend sind nämlich nicht die Brüche, die es zwischen Demokratien und Diktaturen in ihrem instrumentellen Umgang mit Musik gibt, sondern die Kontinuität zwischen ihnen, sodass der vielbeschworene Zivilisationsbruch, der 1933 stattgefunden haben soll, etwas schwächer ausfällt und der diktatorische Umgang mit Musik sich erfolgreich als endliche Vollstreckung vernachlässigter kultureller Ideale der Vorzeit aufspielen konnte. Eher erschreckend ist, wie sich die nationalistischen Sozialisten und die bolschewisierten Sozialisten in Deutschland ablösten und sich dabei kulturpolitisch auf das von ihnen verwaltete Erbe deutscher Musik aus feudalen und bürgerlichen Zeiten stützen und stürzen konnten, so als würden sie es jetzt erst recht verwirklichen und dem Volk näherbringen. Und immer schauten die Gebildeten unter den Diktatur-Verächtern passiv bis beifällig zu, weil sie ihre geheiligten Kulturgüter zwar dem Pöbel ausgeliefert empfanden, aber doch auch anerkannten, dass sie „gepflegt“ und heroisch erhöht würden.
Was die Frage nach den Voraussetzungen für jegliche politische Instrumentalisierung der Kunstform Musik betrifft, so suchen die Autoren sie zunächst in dem Charakter von Musik selbst, in ihrer intensiven Wirkung auf die Emotionen und die Seele der Menschen und den Sog, den sie beim gemeinsamen Hören erzeugt – Gemeinschaft stiftende Eigenschaften, die sich politische Ideologen, die Einfluss auf Massen von Menschen gewinnen wollen, gezielt zunutze machen. Aber dies scheint nur für bestimmte Musik zu gelten. Es gibt durchaus derartig komponierte und aufzuführende Musik, dass sie zwar die Sinne anspricht, aber auch den distanzierenden Verstand nicht ausschaltet, so intim und wenig wichtigtuerisch ist, dass sie für kollektive Sogwirkungen und emotionale Manipulationen von Massen ungeeignet ist. Wenn eine der Autoren (in diesem Fall Juliane Riepe, weil jeder Abschnitt in dem Buch von einer der Autoren gezeichnet wurde) hier unwidersprochen Goebbels (ähnliche Äußerungen könnte man nicht nur von einem bolschewistischen Musikkommissar, sondern auch von vielen bürgerlich-demokratischen Kulturpolitikern hören) zitiert, so erlaubt sie ihm, seine interessiert totalisierende, dennoch selektive Auffassung von der emotionalen und kollektivierenden Macht der Musik für das Ganze der Musik zu nehmen, womit aber in Wirklichkeit ein nicht geringer Teil von Musikwerken ‑ als für solche Instrumentalisierung ungeeignet ‑ ausgeschlossen wird. Im Umkehrschluss heißt das (und das öffentliche Musikleben beweist es täglich), dass zur emotionalen Überrumpelung und kollektiven Suggestion untaugliche Musik in allen modernen Gesellschaftsordnungen unbeliebt ist und selten gespielt wird. Juliane Riepe, von der nicht nur die meisten, sondern auch die mehr ins Grundsätzliche und Konzeptuelle gehenden Beiträge stammen, kann das prägnant an dem Begriff von „Größe“ in der Musik und ihrer Indienstnahme für die eigene von den Ideologen angestrebte und vorgetäuschte Größe einsichtig machen. Demgegenüber erscheinen eine Lauten- oder Cembalosuite, eine Flötensonate, ein Minnelied oder ein gregorianischer Choral, aber auch ein Klavier-Nocturne als zu kleinformatige Musikstücke, die für eine politische Instrumentalisierung völlig unbrauchbar sind.
Die Autoren haben sich aufgrund ihrer Erfahrungen entschlossen, Musik an sich für unpolitisch zu halten, im Sinne einer Kunst, die nicht regulierend auf das Zusammenleben der Menschen in staatlichen Verfassungen einwirken will und kann, sondern davon auszugehen, dass Musik im Nachhinein politisiert werden muss, um als politisch gelten zu können. Sie lassen dabei aber den engagierten Komponisten, der seine Musik selber schon im Akt des Schaffens politisiert, außer Acht – ein Versäumnis, das gerade in Bezug auf Händel fatal ist, weil, wie man weiß, zahlreiche seiner Oratorien veranlasste, beabsichtigte und berechnete, künstlerisch kalkulierte politische Hintergründe und Wirkungen hatten und haben sollten, in Form politischer Allegorien oder historischer Reminiszenzen an die Unterdrückung und Befreiung ganzer Völker, in Analogie zu aktuellem Geschehnissen auf der großbritischen Inselgruppe. Der politischen Stimmung der Zeit folgend war der Wahlengländer Händel nicht abgeneigt, Parallelen zwischen der altjüdischen und der neuenglischen Geschichte zu ziehen, obwohl das englische Volk gegenüber seinen Nachbarn (besonders den Schotten und Iren) wohl eher die Rolle einer unterdrückenden als einer unterdrückten Nation zu spielen bereit war. Auch in Deutschland wurden Oratorien Händels gerne zur Feier nationaler Siege und Überhebungen verwendet. Der Musikmissbrauch für politische Zwecke ist also nicht nur, wie die Autoren selber betonen, so alt wie die Musik selbst, sondern lag auch allzu oft schon in der Absicht mancher Komponisten.
Eine weitere der vielen wichtigen Fragen, welche von den Autoren in systematischer Reihenfolge bearbeitet werden, ist jene nach der Prädestination von musikalischen Gattungen, Werken und Komponisten dafür, politisch instrumentalisiert zu werden. Hier gibt es eine wichtige Beobachtung, nämlich, dass die im bürgerlichen Musikleben obligatorische Bildung eines Kanons, aus dem dann das Repertoire der staatlich subventionierten Konzerte und Opernaufführungen entwickelt wird, einer Instrumentalisierung von auserkorenen und verherrlichten Hauptwerken der Musikgeschichte vorausarbeitet. Es gibt aber auch bedenkenswerte Abweichungen von dieser der Barbarei Vorschub leistenden Regel, die meist mit der Wahrung der Qualität und des guten Geschmacks gerechtfertigt wird. Gerade das Entstehen der sogenannten Händel-Renaissance in der 1920er Jahren stand quer zum Opernrepertoire der Zeit, führte zu dessen Erweiterung und hatte wohl, angesichts der Zerrissenheit der Moderne, mit dem Bedürfnis nach Einfachheit, Klarheit und intensivem, aber eindeutigem Gefühlsausdruck zu tun, was man in Händels den Protagonisten zugeschriebenen Musik zu finden hoffte. Interessant auch die Beobachtung, dass neue Musik, die man für ideologische Zwecke maßgeschneidert hätte komponieren lassen können, zwar in der DDR gefordert und gefördert wurde, während im „Dritten Reich“ die Musik-Indoktrinatoren meinten, die Periode einer Neuen Musik sei nun überwunden und man müsse zur Wiederrichtung der durch die Moderne verloren gegangenen Traditionen übergehen. Vielleicht ist aber auch nur die trotzdem entstandene neue Musik aus der Zeit der Nazi-Herrschaft nur zu wenig bekannt oder noch nicht ausreichend erforscht.
Die Sprache beider Autoren ist sachlich aber nicht trocken, eher leichtfüßig und federnd. Es gibt begriffliche Klopse und Entgleisungen – muss man solche Ungetüme wie „Politizität“ oder „Inkompatibilitäten“ bilden?, außerdem wird der Begriff des Akteurs, ein letzter Schrei aus der Kultursoziologie, etwas überstrapaziert. Aber das sind Randerscheinungen.
Das seitenstarke Buch entfaltet in seinem weiteren Verlauf eine Unmenge von Fallstudien, im Besonderen zu Händels Opern und Oratorien, soweit sie Historien vertonen, die hier nicht alle gewürdigt werden können. Hauptschauplätze sind die Händelfestspielorte Halle, Göttingen (die Konkurrenz zwischen beiden Städte rührte schon von der Weimarer Zeit her, verschärfte sich aber während des ideologischen Krieges im Rahmen des Ost/West-Konflikts) sowie Karlsruhe. Hier werden Ross und Reiter genannt, die Fülle der involvierten Personen ‑ meistens Parteifunktionäre der NSDAP oder der SED, aber auch viele Musiker, Wissenschaftler und Journalisten ‑ ist kaum übersehbar, und es lohnt, sich einige genauer anzuschauen. Die Fallstudien wirklich genau zu lesen, kann jedem an diesen Fragen interessierten Musikkenner und -liebhaber nur dringend empfohlen werden, um die Techniken der Instrumentalisierung nach vollzogener ideologischer Verblendung zu studieren.
Das Buch basiert auf einer bereits im gleichen Verlag und der gleichen Buchreihe erschienenen Quellenband, der auch schon analytische Beiträge enthielt, so wie hier noch einmal das gesamte Quellenmaterial nicht nur aufgelistet ist, sondern auch weitere Dokumente mitgeteilt und zitiert werden. Die methodische Strenge, mit der die einzelnen Aspekte des Phänomens der politischen Instrumentalisierung, auch die mit ihr zwischen den Akteuren verbundenen Kontroversen aufgefächert werden, ist singulär, die argumentative Dichte beeindruckend und die Genauigkeit der Schilderungen des Händel-Kults verschiedener politischer Observanz äußerst erfrischend und erhellend, letztlich natürlich niederschmetternd, wenn man an das traurige Schicksal der Musik und ihres Schöpfers denkt. Die geschilderten Machenschaften und ideologischen Voraussetzungen eines allseitigen und allzeitigen politischen Musikmissbrauchs lässt keine Illusionen aufkommen, am wenigsten jene, die zu ziehenden Lehren wären rein historische, und wir hätten es heutzutage weiter gebracht. Indirekt ist es ein Plädoyer dafür, eine andere, kleinere, leisere, nicht-gigantomanische, eigentlich leicht auffindbare Musik zu suchen, aber auch dafür, die durch Instrumentalisierung dauernd beschädigte Musik von propagierten Großmeistern wie Händel einer war und ist, mit anderen Ohren zu hören, wie es die Alte-Musik-Bewegung ursprünglich einmal vorhatte.
Peter Sühring
Bornheim, 30.12.2021
