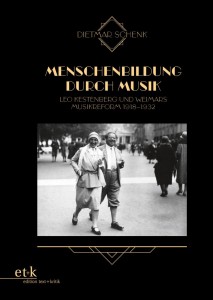 Dietmar Schenk: Menschenbildung durch Musik. Leo Kestenberg und Weimars Musikreform 1918‑1932 – München: edition text + kritik, 2023. – 437 S.: Abb.
Dietmar Schenk: Menschenbildung durch Musik. Leo Kestenberg und Weimars Musikreform 1918‑1932 – München: edition text + kritik, 2023. – 437 S.: Abb.
ISBN 978-3-96707-518-2 : € 42,00 (geb.; auch als eBook)
Eine der mit der Wirkung von Musik verbundenen großen Illusionen ist die idealistische Annahme, das Hören von Musik könnte Menschen zu besseren, höheren Menschen bilden. Die gutwilligen Bemühungen, von Staats wegen auch den unteren Schichten der Bevölkerung einen mental bekömmlichen Musikgenuss zu ermöglichen durch erzieherische Maßnahmen und großzügige Angebote, gehört in diesen neuhumanistischen Zusammenhang kulturpolitischer Anstrengungen, die in mustergültiger und vorbildlicher Weise in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts von Leo Kestenberg verkörpert wurden. Der Historiker und Archivar Dietmar Schenk hat nach der von ihm teilweise mitbetreuten Ausgabe der Schriften und Briefe Kestenbergs in vier Bänden und nach einer von ihm mitorgansierten Kestenberg-Tagung nun die Summe dieser von ihm mitgetragenen Wiederbelebung der Ideen Kestenbergs gezogen in Form einer auf die Weimarer Zeit konzentrierten monografischen Darstellung von dessen Reformvorhaben innerhalb eines politisch von inneren Kämpfen der Weimarer Republik geprägten Umfelds.
Zu den Fragen und Einwänden, die sich an Kestenbergs Konzept von Seiten des Rezensenten knüpfen, und die auch die umfassende und detaillierte Darstellung Schenks nicht entkräften konnte, kann hier ‑ um sie nicht noch einmal zu wiederholen ‑ nur auf die früheren Rezensionen der Bände der Schriften Kestenbergs und der Kestenberg-Tagung auf dieser Plattform verwiesen werden.
Idee und Wirklichkeit der von Kestenberg betriebenen Weimarer Musikreform wird von Schenk ideengeschichtlich hergeleitet und realpolitisch von der faktischen Seite her, d.h. in dem, was sie für die Volksoper, die Musikhochschule und für die Anfänge des Rundfunks und den Tonfilm bedeutete, beschrieben.
Von den altgriechischen Modellen ethischer Wirkung der Musik, der Auswahl bestimmter Tongeschlechter, die positiv auf das Verhalten in der Polis, insbesondere der Jugend einwirken sollen, angefangen, zieht sich ein musikpolitischer Weg bis hin zu den musikalischen Erziehungsprojekten im Rahmen der preußischen Reformen des 19. und 20. Jahrhunderts. In ihnen wurde in der Lesart Kestenbergs unter Berufung auf Goethe, Zelter und Humboldt sowie auf die Lebensformen der Renaissance die reiche Tradition des geselligen und privaten Musizierens gegen den bildungsbürgerlichen Musikbetrieb ins Feld geführt. Auch Schenk denkt hier völlig zu Recht an von die von Wilhelm von Humboldt veranlassten, vom Goethe-Freund Carl Friedrich Zelter formulierten mehreren Denkschriften. Er verfolgt aber ihre Linie, die eine durchaus konservative war, nicht bis zu den späteren Interventionen von Eduard Grell, Heinrich Bellermann und Gustav Jacobsthal. Sie alle basierten letztlich auf Goethes, von Schenk nur kurz gestreiften, den Schweizer Reformern um Pestalozzi nachempfundenen pädagogischen Gedanken in dessen sogenannter „Pädagogischen Provinz“, die er in Wilhelm Meisters Wanderjahren ausformulierte, vielmehr dem „Aufseher“ der Provinz im 1. Kapitel des 2. Buches in den Mund legte. Auch Goethes Fragment Tonlehre spielte in diesem Zusammenhang eine nicht zu vernachlässigende Rolle.
Es brauchte dann nach dem letzten Memorandum an das preußische Kulturministerium in Goetheschem Geist, jenem von Jacobsthal aus dem Jahr 1883, ein weiteres halbes Jahrhundert bis man in Berlin in musikpädagogisch interessierten resp. institutionell tätigen Kreisen wieder auf Goethes „Pädagogische Provinz“ als Quelle grundlegender Überlegungen zur Musikerziehung stieß. Und hier spielte die Zusammenarbeit von Georg Schünemann (Professor und stellvertretender Musikhochschuldirektor) mit Kestenberg eine entscheidende Rolle, denn Schünemann war es, der Kestenberg auf Wilhelm Meisters Wanderjahre verwies. Er war es, der im Dezember 1922 den als Musik-Referenten im preußischen Kultusministerium tätigen Leo Kestenberg gesprächshalber und in Vorbereitung auf eine von Kestenberg zu verfassende neuerliche Denkschrift zur privaten und schulischen Musikerziehung auf die Goethe-Fährte setzte. Kestenberg schrieb nach dessen Lektüre: „Unser Gespräch hat mich noch die halbe Nacht beschäftigt. Heute habe ich in der ’pädagogischen Provinz’ Goethes nachgelesen und vieles gefunden, was für uns von unmittelbarer Bedeutung sein kann“ (Siehe L. Kestenberg, Brief an Georg Schünemann vom 29. Dez. 1922, in: Briefe an Georg Schünemann, in: Briefwechsel, 1. Teil, Gesammelte Schriften 3.1, Freiburg 2010, S. 133).
Obwohl es eher unwahrscheinlich ist, dass dem Berliner reformpädagogischen Dreigestirn der Weimarer Zeit, Kretzschmar, Kestenberg und Schünemann, die Gedankengänge und Argumente ihrer preußischen Vorgänger unter den Musikreformern noch geläufig waren (Kestenberg nennt in seiner Schrift Musikerziehung und Musikpflege ‑ wieder abgedruckt in: Die Hauptschriften, S. 48f. – unter den für ihn relevanten Musikwissenschaftlern der Vergangenheit, die sich mit Musikerziehung beschäftigt hätten oder für diese auf universitärem Sektor von Belang gewesen seien, an Berlinern nur Karl von Winterfeld, Adolph Bernhard Marx und Philipp Spitta), wäre es doch angebracht gewesen, auf diese verborgene Tradition als Vorgeschichte der späteren Weimarer Reformbestrebungen Kestenbergs hinzuweisen.
Inwieweit Kretzschmars, Kestenbergs und Schünemanns Dokumente wiederum der heutigen Berliner und Potsdamer Schul- und Wissenschaftsverwaltung noch geläufig sind, ist ebenso fraglich. Man könnte sie heutzutage mit gewissen Abstrichen wieder erneut einreichen, denn der Musikunterricht in den deutschen Bundesländern Berlin und Brandenburg droht wohl wieder jenen historischen Tiefstand zu erreichen, der Zelters Initiativen damals verursachte.
Eine etwas andere, ausgesprochen antifeudale und bürgerlich-demokratische (also damals linke) Linie vertrat in diesen musikpädagogischen Fragen und in Forderungen an den Staat bereits Adolph Bernhard Marx (in seiner Denkschrift über die Organisation des Musikwesens im preußischen Staate, die im September 1848 in der Berliner Musikzeitung erschien) und eine konsequent sozialistische bereits Theodor Hagen in seiner Schrift Civilisation und Musik von 1846. Es ist in diesem Zusammenhang besonders pikant, dass der Literaturhistoriker Hermann Hettner 1852 urteilte, die Ideale der von Goethe geschilderten Turmgesellschaft in den Wanderjahren Wilhelm Meisters zeige, dass Goethe „in seinem späten Greisenalter sich so angelegentlich die Zukunft des Staats- und Gesellschaftslebens zum Gegenstand der Betrachtung gewählt hat, daß er in der Tat der erste deutsche Sozialist genannt werden muß“. Damit folgte Hettner aber nur einem anderen preußischen Gelehrten, einem Absolventen von anderen Wanderjahren, Ferdinand Gregorovius, der 1849 in einer Schrift „Goethes Wilhelm Meister in seinen sozialistischen Elementen entwickelt“ hatte. Das könnte ein geheimer Faden gewesen sein, der Kestenbergs sozialreformerischen Ideen zur Musikerziehung in der 1920er Jahren mit denen Goethes verband. Diese ideengeschichtlichen Verknüpfungen herzustellen, hätte auch eine Aufgabe im Rahmen von Schenks Kapitel zur Vorgeschichte der Weimarer Musikreform sein können.
Die widerstreitenden politischen Tendenzen in der Weimarer Republik, die sich auch auf dem Gebiet der Kulturpolitik in dem Gegensatz einer reformfreudigen sozialdemokratischen Regierung in Preußen zu den wachgehaltenen reaktionären Tendenzen der alten vorrevolutionären Gesellschaft niederschlugen, führten schließlich, und zwar schon 1932, zu einer erstaunlich widerstandslos hingenommenen Entmachtung der preußischen Regierung durch eine konterrevolutionäre Reichsregierung. Man kann zudem feststellen, dass die Grenzen zwischen den Reformern von Musik und Gesellschaft einerseits und den verschiedenen Spielarten konservativer bis reaktionärer kultureller Strömungen andererseits, die ihre Wurzeln noch in der Spießerideologie des Kaiserreichs hatten, fließend waren. Nicht nur war die Verführbarkeit bürgerlichen Geistes, in Nationalismus und Untertanengeist abzusinken, groß, sondern auch der proletarische Geist war durch Parolen für eine übermächtige Gemeinschaft und einen Staatssozialismus anfällig geworden für totalitäre Stimmungen. Sonst wäre nicht erklärbar, warum ein enger Mitarbeiter Kestenbergs für eine demokratische und soziale Reform des Musiklebens wie Georg Schünemann anscheinend über Nacht zu einem Überläufer zum Nationalsozialismus hatte werden können. Eine Frage, die von Schenk nicht gestellt wird.
Bedauerlich ist, dass Schenk bei der Beschreibung der auf sozialen Fortschritt und Völkerverständigung gerichteten Bestrebungen in der Weimarer Republik, speziell bei der Schilderung der 1927 in Frankfurt stattfindenden Ausstellung Musik im Leben der Völker deren leitende Kuratorin und Katalog-Herausgeberin Kathi Meyer nicht eigens erwähnt. Sie war dafür verantwortlich, dass die Ausstellung neben kulturhistorischen auch sozialgeschichtliche, psychologische, ethnologische und technische Aspekte von Musik umfasste und als „musikalische Weltausstellung“ tituliert wurde. Gut kann Schenk aber deutlich machen, wie sehr diese mit Kestenbergs Berliner Bestrebungen korrespondierende Ausstellung eine Ausnahme war und in einem chauvinistisch vergifteten Umfeld stattfand.
Die zwischen nationalem Partikularismus und Universalismus schwankenden Tendenzen in der zionistischen Bewegung, die sich auch im Aufbau eines jüdischen Staates in Palästina zur Zeit Kestenbergs widerspiegelten, sind Gegenstand einer von Schenk erzählten Nachgeschichte. Hier geht es musikalisch um das Anknüpfen an die Reorientalisierung der jüdischen Musik durch Anknüpfen an die althebräischen synagogalen und säkularen Traditionen, aber auch um Kestenbergs religiöse Wende, die seine Anschauungen in seiner späten israelischen Zeit bestimmte. Hier erscheint Kestenberg stark verändert und etwas anachronistisch, verglichen mit seinen Ideen, die er aus Europa mitgebracht hatte.
Diese werden in einem Anhang von Schenk nochmals präsentiert und kommentiert durch den Wiederabdruck entlegener Veröffentlichungen, die auch den Weg in die Ausgabe der Gesammelten Schriften nicht gefunden hatten: Arbeiterschaft und neue Musik (1929), Arbeitergesang und Volksbildung (1931) und Bekenntnis zu Kokoschka (1931). Dass das Kestenberg-Bild nicht einheitlich, sondern umstritten ist, deutet Schenk im Abschnitt, der dem aktuellen Forschungs- und Diskussionsstand um Kestenberg gewidmet ist, an. Zeittafel, Quellen- und Literaturverzeichnis sowie Personenregister machen das Buch übersichtlich und erschließbar. Schade ist, dass das vorgesetzte Inhaltsverzeichnis die vielen interessanten Unterabschnitte innerhalb der Kapitel und Unterkapitel nicht einzeln aufführt.
Peter Sühring
Bornheim, 19.12.2024
